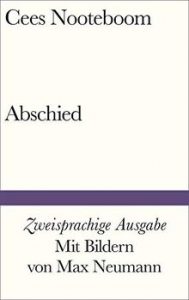Flaschenpost aus finsteren Zeiten – Sebastian Haffners Roman „Abschied“
Ob Männer oder Frauen, alle umschwirren die geheimnisvolle Teddy wie Motten das Licht. Vor den strengen Eltern ist sie von Berlin nach Paris entflohen. Hier haust sie in einer Mansarde, flaniert auf den Boulevards, streift durch Museen, feiert mit Freigeistern und Lebenskünstlern das Jetzt.
Um seiner früheren Geliebten wieder nah zu sein, hat sich Rechtsreferendar Raimund Pretzel ein paar Tage von seinem tristen Berliner Alltag losgeeist und sich auf den Weg nach Paris gemacht, genießt das Glück des Augenblicks und freut sich über jeden Kuss, den er von seiner Angebeteten erbetteln kann. Die Zeit fliegt nur so dahin. So viel gäbe es noch zu erleben in dieser Stadt der Liebe und der Kunst! Doch der Zug, der Raimund zurück nach Berlin bringen wird, wartet nicht. Die Stunde des Abschieds naht, und beide wissen, es wird ein Lebewohl für immer sein. Denn am Horizont lauert bereits der Zivilisationsbruch, der das Böse an die Macht bringen, die Welt ins Kriegs-Chaos stürzen und den Untergang einer ganzen Epoche herbei führen wird.
Aus den Tiefen der Archive ist jetzt ein Manuskript aufgetaucht, eine Flaschenpost aus der Vergangenheit, eilig hingeworfen im Herbst 1932 von einem vierundzwanzigjährigen Autor, der sein eigenes Leben in Literatur verwandelt, mit prophetischer Gabe die große Katastrophe kommen sieht und „Abschied“ nimmt von allem, was ihm bis dahin lieb und teuer war.
Raimund Pretzel, den Erzähler des bisher unveröffentlichten Romans, hat es wirklich gegeben. Und alles, was er so temporeich und freizügig beschreibt, auch seine unerwiderte Liebe zur lebensfrohen Teddy, beruht auf realen Erlebnissen. Wir kennen ihn heute besser als Sebastian Haffner, also unter jenem Namen, den der ehemalige Jurist, der den Nazis nicht länger dienen wollte und sich lieber mit journalistischen Arbeiten durchschlug, annahm, nachdem er 1938 Deutschland verließ und seiner jüdischen Frau nach Großbritannien folgte. Nach seiner Rückkehr aus dem Exil wurde er ein zentraler und meinungsstarker Publizist der Bonner Republik und entschlüsselte mit seinen „Anmerkungen zu Hitler“ auf der Folie gesellschaftlicher Verwerfungen die politischen Abgründe und massenpsychologischen Dimensionen des Faschismus.
Teddy, die im Roman die Vielfalt des Lebens feiert und jede Engstirnigkeit verabscheut, hieß im wahren Leben Gertrude. Als Jüdin ahnte sie früh, was auf sie zukommen würde und kehrte Berlin 1930 den Rücken. Nur einmal noch, 1933, kehrte sie kurz nach Berlin zurück und nahm Abschied von Deutschland und von Raimund, den sie noch einmal mit ihrem Pariser Duft und ihrer französischen Freiheitsliebe verzauberte.
Bis ins hohe Alter haben die beiden, die im Roman gemeinsam durch Paris irrlichtern, bevor sie Abschied nehmen und in den Höllenschlund der Vernichtung blicken, lockeren Kontakt gehalten.
Sebastian Haffner: „Abschied“. Roman. Mit einem Nachwort von Volker Weidermann. Hanser, 192 Seiten, 24 Euro.