Natur und Kunst, Schönheit und Grauen: Vor 150 Jahren starb der Biedermeier-Schriftsteller Adalbert Stifter
Kann man ihn überhaupt noch lesen, diesen Biedermeier-Schriftsteller? Ist seine Sittlichkeit nicht längst altmodisch? Sind diese langatmigen Schilderungen von Landschaften und Naturidyllen nicht jedem modernen Gefühl zuwider? Fehlt ihm nicht, was schon Joseph von Eichendorff vermisste, der über ihn sagte, er habe „nicht eine Spur von moderner Zerrissenheit“?
Adalbert Stifter, vor 150 Jahren (am 28. Januar 1868) gestorben, galt einst als der bedeutendste Autor des Biedermeier. Man schätzte seine Naturdarstellungen. Bis in die 1960er Jahre hinein war seine Prosa Stoff für die Schule, seine Texte fanden sich in Lesebüchern. Werke wie „Die Mappe meines Urgrossvaters“, seine Erzählungs-Sammlung „Bunte Steine“ oder sein wohl berühmtester Roman „Der Nachsommer“ gehörten zum literarischen Bildungsgut.
Sogar Karl Kraus hat ihn gepriesen
Der Philosoph Friedrich Nietzsche etwa bewunderte diesen groß angelegten Bildungsroman und zählte ihn – neben Goethe – zum „Schatz der deutschen Prosa“. Der scharfzüngige Karl Kraus ließ allein Stifter unter allen Schriftstellern dieser Epoche gelten, die anderen „sollten diesen Heiligen für ihr lautes Dasein um Verzeihung bitten …“. Und kein Geringerer als Thomas Mann preist ihn in höchsten Tönen: „Stifter ist einer der merkwürdigsten, hintergründigsten, heimlich kühnsten und wunderlich packendsten Erzähler der Weltliteratur.“
Die Sprache bleibt für die Gegenwart
Kritiker dagegen bemängeln, dass die Figuren seiner Werke als Menschen blass bleiben und hinter den allzu ausgiebigen Natur- und Landschaftsschilderungen zurücktreten. Sein Stil wird als weitschweifig getadelt. „Die Ergebenheit in alles von der Natur Vorgegebene beginnt selbst den geneigten Leser zu martern“, schreibt Ilse Aichinger über seine Erzählung „Bergkristall“. Was für heute bleibt, glaubt man der österreichischen Schriftstellerin, ist die Sprache: Sie „entdeckte in der Schilderung die Definition der Räume und Landschaften, in der Gelassenheit und Ergebenheit den reißenden, fast verzweifelten Strom der Sprache, ihre Hochkarätigkeit, den Tod zu ihren Seiten.“
Das Abgründige in Stifters Werk, das wohl auch Franz Kafka erspürt hatte, die Natur als Raum und Spiegel der Seele – das braucht offenbar Zeit und Einfühlung, um entdeckt zu werden. Das Grauenvolle, Unergründliche, zutiefst Erschreckende, dessen Walten in der Natur Stifter eben auch entdeckt, hat man gern und geflissentlich übersehen.

Solche Bilder leisteten der Idyllisierung Vorschub: Adalbert Stifter, „Im Gosautal“, ein Gemälde aus dem Jahr 1834. Bild: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Adalbert_Stifter_-_Im_Gosautal.jpg
Sehnsucht nach Harmonie
Adalbert Stifter, 1805 in Oberplan an der Moldau in Böhmen (heute Horni Planá in Tschechien) geboren, stammt aus den armen Verhältnissen einer Leinweberfamilie. Der Großvater brachte ihn auf die Lateinschule und ab 1818 in das Stiftsgymnasium der Benediktiner von Kremsmünster. Eine Zeit, die er später als die schönste seines Lebens beschrieb. Er lernte Zeichnen und wollte Landschaftsmaler werden – einige Bilder zeugen von seinem Talent.
Die Schule vermittelte ihm Religion, Philosophie, Kunst und Naturwissenschaft gleichermaßen, führte ihn in den Kosmos der christlichen Weltanschauung ein, unterwies ihn aber auch in der Philosophie der Aufklärung. Im Schönen entdeckte er das Göttliche. Das Göttliche aber strebe, so schrieb er selbst, überall nach beglückender Entfaltung, als Gutes, Wahres, Schönes. Die Sehnsucht nach dieser harmonischen Weltschau sollte sein späteres Denken und Schreiben prägen.
Unglückliche Liebe und materielle Not
Als Student der Rechte in Wien begann er auch zu dichten. In Wien verliebte er sich heftig und unglücklich in Fanny, die Tochter eines wohlhabenden Kaufmanns. Sie erwiderte seine Leidenschaft nicht. Stifter verfiel dem Alkohol und musste das Studium ohne Abschluss abbrechen. In dieser Zeit entstanden erste Erzählungen, die aber nicht oder erst später veröffentlicht wurden. Um die Ordnung in seinem Leben wieder herzustellen, vermählte sich Stifter mit der Putzmacherin Amalia Mohaupt, die ihn über 30 Jahre lang liebevoll umsorgte.
In den ersten Jahren plagten das Paar erhebliche materielle Sorgen. Die Lage wandelte sich allmählich, als 1840/41 die Erzählungen „Der Condor“ und „Feldblumen“ veröffentlicht wurden und auf positives Echo stießen. Stifter unterrichtete als Hauslehrer den Sohn des österreichischen Staatskanzlers Metternich und fand einen Verleger, der ihn förderte. Die Schicksalserzählung „Abdias“ brachte ihm 1842 den literarischen Durchbruch. Zwei Jahre später erschienen erste Bände seiner gesammelten Erzählungen.
Keine Gegenliebe für pädagogische Reformideen
Im Revolutionsjahr 1848 zog Stifter, der auf der Seite der Erneuerung stand, von Wien nach Linz. Die Erzählung „Die Landschule“ spiegelt sein lebenslanges pädagogisches Interesse wieder. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es ihm, 1850 einen Posten als Schulrat zu erreichen.
Gut zwei Jahre später wurde er auch zum Landeskonservator für Oberösterreich der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale ernannt. Sehr engagiert widmete er sich dem Denkmalschutz und der Förderung der bildenden Kunst, in der er die „irdische Schwester der Religion“ erkannte. Seine pädagogischen Reformideen jedoch stießen bei Kirche und Behörden nicht auf Gegenliebe.
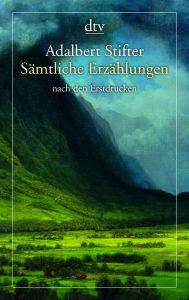
Neu bei dtv: Wolfgang Matz hat Stifters Erzählungen nach den Erstdrucken herausgegeben – rechtzeitig zum 150. Todestag des Autors.
Gesundheitliche Gründe und ein Schicksalsschlag – der Tod seines Adoptivkindes Juliane, wohl ein Suizid – führten dazu, dass Stifter seinen Tätigkeiten nicht mehr nachgehen konnte. Seinen historischen Roman „Witiko“ vollendete er nach jahrelanger Arbeit.
Stifter war ein übermäßiger Esser und Trinker, der sechs Mahlzeiten am Tag verschlang. Als sein Tod infolge einer Leberzirrhose absehbar war, öffnete er sich auf dem Krankenbett mit einem Rasiermesser die Halsschlagader und starb zwei Tage nach diesem Suizidversuch am 28. Januar 1868.
Neue Bücher:
Der Münchner Literaturwissenschaftler, Lektor und Träger des Paul-Celan-Preises Wolfgang Matz hat 2016 mit „Adalbert Stifter oder Diese fürchterliche Wendung der Dinge“ eine Biografie auf aktuellem wissenschaftlichen Stand vorgelegt.
Stifters großer Roman „Der Nachsommer“ ist in einer neuen Ausgabe beim Deutschen Taschenbuch-Verlag (dtv) erhältlich, der auch „Bergkristall“ und „Witiko“ im aktuellen Programm führt. Wichtige Werke von „Abdias“ bis „Bunte Steine“ sind als gelbe Reclam-Ausgaben erhältlich.
Hier noch ein Gedicht von Adalbert Stifter:
Abschied
Nun sind sie vorüber, jene Stunden,
Die der Himmel unsrer Liebe gab,
Schöne Kränze haben sie gebunden,
Manche Wonne floß mit ihnen ab.
Was der Augenblick geboren,
Schlang der Augenblick hinab,
Aber ewig bleibt es unverloren,
Was das Herz dem Herzen gab.

