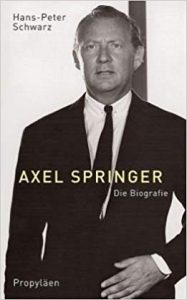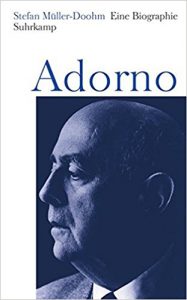Der lange Schatten von Auschwitz – Michel Laubs Roman „Tagebuch eines Sturzes“
Ob nach Auschwitz sich noch leben lasse, war eine zentrale Frage, die der Philosoph Theodor W. Adorno gestellt hat. Er gab damit einen Anstoß, über Sinn und Wert des Lebens, über Schuld und Verantwortung angesichts der NS-Gräuel nachzudenken. Was der Vertreter der Frankfurter Schule gesellschaftlich und historisch zu hinterfragen suchte, reflektiert Michel Laub am Beispiel (s)einer Familie.
Der Autor, jüdischer Herkunft, ist Journalist, Jahrgang 1973, und wurde im brasilianischen Porto Alegre geboren. In seinem autobiographischen Roman „Tagebuch eines Sturzes“ erzählt er die Lebensgeschichte seines Großvaters, seines Vaters und seiner selbst. Laub, der in seiner Heimat zu wichtigsten zeitgenössischen Autoren gehört, beschreibt über weite Strecken in einzelnen Sequenzen, Szenen oder Momentaufnahme, was der Angehörige einer jeweiligen Generation erlebt und durchlitten hat.
Das Buch ist in Ich-Form geschrieben. Für den Erzähler ist der Anlass, sich zurückzunehmen und Rückschau zu halten, wahrlich schwierig genug: Er hat ein Alkoholproblem, seine Frau (die mittlerweile 3. Ehe) droht mit dem Ende der Beziehung und der Vater hat gerade von Ärzten erfahren, an Alzheimer erkrankt zu sein.
Da ist das Wort von der persönlichen Krise wohl durchaus erlaubt. Wenn der Schriftsteller nun Verbindungen mit Auschwitz herstellt, mag das im ersten Moment befremdlich erscheinen, im Gesamtkontext der Familie wird es verständlich. Sein Großvater nämlich hat das KZ überlebt und nach dem Krieg in Brasilien ein neues Leben als Geschäftsmann begonnen. Kann man aber hier wirklich von Leben sprechen?
Sein Opa, den er selbst nie kennenlernte, hat nichts über Auschwitz gesagt oder berichtet. Seine Erinnerungen verarbeitete er stattdessen in einem Tagebuch, das er nach Feierabend führte, wozu er sich in sein Arbeitszimmer zurückzog. Treffender wäre wohl das Wort „verbarrikadierte“. Was er niederschrieb, erfuhr seine Familie erst nach seinem Tod und bekam einen Eindruck davon, wie sehr er unter den Erlebnissen im Konzentrationslager zu leiden hatte, in dem auch zahlreiche Verwandte starben. Diese seelischen Qualen waren es schließlich auch, die dazu führten, dass er Selbstmord beging. Sein Sohn, damals 14 Jahre alt, fand den Vater tot im Arbeitszimmer. Das Trauma überwand er nie, und auch sein Sohn, der Erzähler, spürte stets, wie sehr sein Vater unter dem psychischen Druck zu leiden hatte.
Auch wenn kein kausaler Zusammenhang zu dem Geschehen, das den jüngsten Nachfahren aufwühlen soll, besteht, stimmt es doch nachdenklich, dass auch er mit einem schwierigen Ereignis zurechtkommen muss. Hierbei ist er allerdings nicht Opfer, sondern gehört zum Kreis der Täter. Er besucht ein jüdisches Gymnasium. Als der einzige nicht-jüdische Mitschüler in der Klasse bei der eigenen Feier zum 13. Geburtstag entsprechend der Anzahl der Lebensjahre in die Luft geworfen wird, fangen ihn seine Mitschüler beim letzten Mal nicht mehr auf. Joao, so der Name des Jungen, war stets Außenseiter und wurde gemobbt. Mit schweren Verletzungen kommt er ins Krankenhaus und als er nach Monaten in die Schule zurückkehrt, ist der Erzähler der einzige, der sich um ihn kümmert. Das Gewissen hat ihn seit dem Fest geplagt. Eine Freundschaft aufzubauen scheitert indes, trotz mancherlei Bemühungen.
Zurück bleibt der Erzähler mit dem Gefühl des Versagens und des Scheiterns. Überhaupt tut er sich schwer mit dauerhaften Bindungen und versucht, die Gründe herauszufinden. Vater und Großvater sind dabei wichtige Glieder in einer Ursachenkette. Der Titel „Tagebuch eines Sturzes“ wird am Ende zu einer Aussage, die mehr meint als „nur“ das Geschehen um den nicht-jüdischen Jungen.
Michel Laub: „Tagebuch eines Sturzes“. Roman. Klett-Cotta-Verlag, Aus dem brasilianischen Portugiesisch übersetzt von Michael Kegler. 176 Seiten. 19,95 Euro.