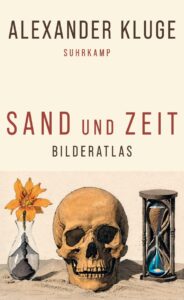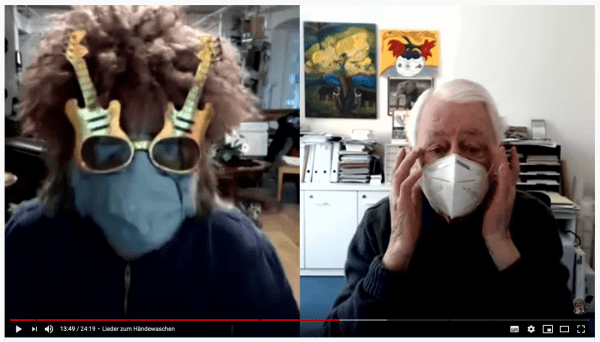Bis die Kriegsgewalt bröckelt – Alexander Kluges Bilderatlas „Sand und Zeit“
Da haben wir also wieder ein Buch vom inzwischen 93-jährigen Polyhistor Alexander Kluge, der stets die entferntesten Dinge produktiv zusammen bringt und hellsichtig Funken aus seinen Blickwechseln schlägt.
Diesmal beginnt die fruchtbringende Gedankenreise bei den akuten Verheerungen im Gazastreifen, wo vieles nicht einfach „nur“ zerstört wurde, sondern schier zu Sandkörnern zerriebene Wüstenei geworden ist. Vielfach erwogen wird in der Folge, ob dem allfälligen Krieg und der Gewalt Einhalt zu gebieten sei – ganz gleich, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort des geschundenen Erdenrunds.
Damit wären die beiden Pole des Bandes „Sand und Zeit“ schon einmal benannt. Das zu Sand zermalmte Land kehrt später – gründlich verwandelt – im Kinder-Sandkasten und sodann in „Sandkasten-Spielen“ der Militärstrategen wieder. Auch werden einzelne Sandkörner physikalisch vermessen und mikroskopisch betrachtet. All das gipfelt in einem wesentlich aus Sand bestehenden Kunstwerk von Anselm Kiefer, das wiederum Ingeborg Bachmann seine Inspiration verdankt. Alles kann mit allem zusammenhängen, wenn man es denn recht zu betrachten weiß.
Auf der Suche nach Gegenkräften
Gewisse Gegenkräfte zur Kriegsgewalt, so scheint sich ahnungsvoll zu zeigen, dürften beispielsweise in dennoch abgetrotzten glücklichen Augenblicken liegen. Während der altgriechische Zeitgott Kronos alles fressen will (sogar die eigenen Kinder), verkörpert Kairos den geglückten Moment als kaum minder scharfes Gegengift. Eine vage, aber immer neu mit Zuversicht zu nährende Hoffnung kennzeichnet dieses Motto zu Beginn: „Die einzige Verlässlichkeit in zerrissener Zeit beruht auf der Beobachtung, dass auch die kriegerische Macht stolpert…“ Alle noch so imposanten Imperien der Geschichte, so ein zentraler Befund, stürzen irgendwann, nichts ist von ewiger Dauer. Ein Gedanke, bei dem einem – allem waltenden Elend zum Widerspruch – warm ums Herz werden könnte.
Kluge ruft kreuz und quer verschiedenste historische Szenarien auf – von der deutschen Nachkriegs-Trümmerzeit samt Wiederaufbau über altägyptische und altrömische Verhältnisse (Punische Kriege = Rom vs. Karthago), den jetzigen Ukraine-Krieg, die Kreuzzüge, den Krimkrieg (ab 1853), die Urkatastrophe des Ersten Weltkriegs und den (wenn überhaupt möglich) noch schlimmer wütenden Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs, die Religionskriege, die in den Westfälischen Frieden von 1648 mündeten… Die Phänomenologie so vieler Waffengänge umfasst auch die seltene, vorbildliche Großzügigkeit generöser Sieger, die den Besiegten nach deren Kapitulation zunächst freies Geleit und fortan freie Entfaltung gewähren – beispielhaft erfasst in Velázquez‘ berühmtem Gemälde „Die Übergabe von Breda“.
Immer wieder neue Perspektiven
Geschildert und ausgiebig bildlich dargestellt (auch mit „virtuellen Kameras“, also KI-Hilfe) werden sowohl das große Ganze als auch gleichsam herangezoomte Nahansichten. Da gibt es erschütternde Bilder, die die brüllende Maschinerie des Krieges so vergegenwärtigen, wie es eben geht. Beim Lesen sollte man diese Illustrationen keinesfalls schnell überblättern, sie erheischen nachdrücklich Aufmerksamkeit. Derlei rasche und harsche Perspektivenwechsel, so Kluge im vorsichtig bilanzierenden Nachwort, können die Kontraste der Zeitläufte besser erfassen als reine Texte. Daher nennt er sein Buch im Untertitel „Bilderatlas“. Ein anregendes Vorbild ist ausdrücklich Aby Warburgs legendäre, größtenteils verschollene „Kriegskartothek“ zum Ersten Weltkrieg gewesen. Technisch auf der Höhe, bietet Kluges Buch übrigens auch (teilweise filmische) Ergänzungen an, die man mit Hilfe abgedruckter QR-Codes ansteuern kann.
Einen freien Erzählraum erzeugen
Alexander Kluge muss nicht nur über eine riesige Bibliothek und die Erfahrungen eines langen Lebens, sondern auch unendlich viele „Zettelkästen“ oder eben Datensammlungen verfügen, denen er immer wieder entlegene (und gleichzeitig prägnante) Beispiele entnimmt, so etwa, wenn es um die letzten Kriegstage rund um das Volkswagenwerk oder die zeitgleiche Kapitulation einer deutschen Munitionsfabrik geht.
Es ist Kluge um die Schaffung eines „freien Erzählraumes“ zu tun, um den Konjunktiv als Möglichkeitsraum. Erst im beherzten Sprung auf die andere Seite, in eine andere Zeit, sei es denkbar, die tendenziell verarmten Ausdrucksweisen unserer Tage zu überwinden. Bei Beschwörung des Überblicks kehrt Kluge verbal zu seiner Frühzeit zurück, indem er die hohe Zirkuskuppel als Bild aufruft. Wir erinnern uns an seinen Filmtitel „Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“. Gegen alle Ratlosigkeit geht er im gesegnet hohen Alter immer noch und erst recht an – wie einst Elias Canetti unverdrossen gegen den Tod focht. Das darf und muss man heldenhaft nennen.
Alexander Kluge: „Sand und Zeit“. Bilderatlas. Suhrkamp, 168 Seiten, zahlreiche Abbildungen. 25 Euro.