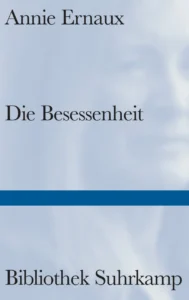„Die Besessenheit“ – Annie Ernaux‘ Selbsterforschung zur Eifersucht
Die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux sieht sich als „Ethnologin ihrer selbst“. Ihre Romane und Erzählungen kreisen immer um ihr eigenes Leben, berichten von schmerzlichen Kindheitserinnerungen, privaten Nöten, erotischen Obsessionen: eine oft quälende, aber immer ungemein aufschlussreiche Lektüre. Leider werden ihre Bücher zumeist mit großer Verspätung ins Deutsche übersetzt: „Die Besessenheit“ (Originaltitel „L’occupation“) ist bereits 2002 in Frankreich herausgekommen.
In klaren Sätzen und fast klinischen Worten beschreibt Annie Ernaux, wie sie von der Wucht einer Eifersucht ergriffen wurde, die sie an den Rand der Selbstauflösung und Selbsterniedrigung führte. Jeder Gedanke drehte sich um eine Frau, von der sie zunächst nichts wusste, außer dass sie die neue Geliebte ihres Liebhabers ist: „Das Sonderbarste an der Eifersucht ist, dass man eine Stadt oder die ganze Welt mit einem Menschen bevölkert, dem man vielleicht nie begegnet.“
Sie will wissen, wie die fremde Frau heißt, wo sie wohnt, was sie beruflich macht. Sobald ihr (ehemaliger) Geliebter, mit dem sie sich immer noch gelegentlich im Café trifft, nur eine kleine Andeutung über die fremde Frau macht, begibt sie sich auf Spurensuche, versucht sich ein Bild dieser geheimnisvollen Fremden zu machen, sieht in jeder Frau, die ihr zufällig auf der Straße oder in der Metro begegnet, ein Spiegelbild der Anderen. „Die Frau füllte meinen Kopf, meine Brust und meinen Bauch, begleitete mich überallhin, diktierte mir meine Gefühle. Gleichzeitig ließ mich diese ständige Anwesenheit intensiver leben.“ Die aus dem Nichts aufgetauchte „Besessenheit“ schärft ihre Sinne, befähigt sie, sich schreibend zu analysieren. Das Schreiben führt zu psychoanalytischer Erkenntnis und seelischer Katharsis: „Ich schreibe über die Eifersucht, so wie ich sie durchlebt habe, indem ich meine damaligen Wünsche, Gefühle und Handlungen aufspüre und erforsche. Schreiben ist im Prinzip nichts anderes als eine Eifersucht auf die Wirklichkeit.“
Nachdem sie einiges über die fremde Frau in Erfahrung gebracht hat, begreift sie, dass sie selbst nicht einzigartig, sondern nur Teil einer Serie im Liebesleben ihres ehemaligen Geliebten ist, der mit Anfang dreißig sich stets zu älteren Frauen hingezogen fühlt: Frauen, die (wie Annie Ernaux und die neue Geliebte) finanzielle Unabhängigkeit mitbringen, vielfältige erotische Erfahrungen und die Fähigkeit zu zärtlicher Bemutterung.
Sich schreibend von der „Besessenheit“ zu befreien, heißt für Annie Ernaux, ihre Scham zu überwinden, ihre Obsessionen zu benennen: „Ich will nur die Fantasien und Verhaltensweisen der Eifersucht erforschen, die in mir am Werk war, will etwas Individuelles, Intimes zu einer greifbaren, verständlichen Substanz machen, zu etwas, das fremde Menschen sich vielleicht aneignen können.“ Genau dieses Kunststück gelingt Annie Ernaux: Denn sie beschreibt nicht nur ihr Verlangen und ihre Eifersucht, sondern ein Verlangen und eine Eifersucht, gibt sich selbst preis und zeigt ihre Wunden, um anderen zu sagen, dass man sich, wenn man radikal ehrlich ist, selbst aus dem Sumpf der „Besessenheit“ emporziehen kann: Ein Buch von großer gedanklicher Klarheit und bedrückender sprachlicher Schönheit.
Annie Ernaux: „Die Besessenheit“. Aus dem Französischen von Sonja Finck. Bibliothek Suhrkamp, 2025, 68 Seiten, 20 Euro.