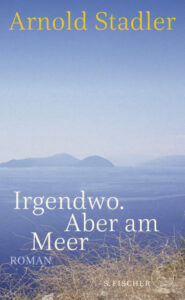Buch der Enttäuschungen – Arnold Stadlers Roman „Irgendwo. Aber am Meer“
Ein Schriftsteller erzählt von seiner edel gerahmten Diskussions-Teilnahme auf Schloss Sayn im Westerwald. Dort hat doch tatsächlich jemand aus dem Publikum gerufen, er sei ein „Alter weißer Mann“ und sondere gestriges Geschwätz ab. Das muss man sich mal vorstellen.
Im Ernst: Der Zwischenruf löst beim Autor schier endlose Reflexionen voller Selbstzweifel aus. Wer will ihn überhaupt noch lesen und hören? Hätte das Publikum lieber Greta Thunberg als ihn erlebt? Ist er denn aus der Zeit gefallen? Tja, das sind Fragen. Und die Leserschaft darf mal wieder an den speziellen Problemen eines beruflich Schreibenden teilnehmen. Da möchte man gern auf Max Goldt zurückkommen, der den herrlichen Vergleich von allzeit gängigen „Künstlerfreundschaften“ mit bislang niemals gewürdigten „Elektriker-Freundschaften“ ersonnen hat.
Arnold Stadler (Jahrgang 1954) legt mit „Irgendwo. Aber am Meer“ ein Buch der Enttäuschungen vor, eine Ich-Beschau des Autors als alternder Mann. Der im Spätherbst des Lebens angelangte Schriftsteller fährt, wie er einige Male betont, einen Dacia Diesel und darf damit wohl (im Urteil der geistlosen Mitwelt, aber auch nach seiner eigenen Befürchtung) als „Loser“ gelten, der nicht allzu „finanzfrisch“ ist, sprich: eher Schulden als Rücklagen angehäuft hat.
Auf seiner Bahn-Heimfahrt von Sayn nach Tuttlingen (immerzu vielsagend kurzgeschlossen mit der dort angesiedelten Erzählung „Kannitverstan“ von Johann Peter Hebel) geht einiges schief. Das platte Land ist halt verkehrstechnisch „abgehängt“. Zu allem Überfluss ist der Handy-Akku leer, desgleichen die Autobatterie, als der Autor am Zielbahnhof einsteigen und losfahren will. Bei derlei Unbill kommen hier ziemlich schnell Todesgedanken auf. Wenn es erst einmal abwärts zu gehen scheint…
Kurz darauf (mit besagtem Dacia) der Aufbruch gen Ithaka – ein Ziel, das der Erzähler noch nie erreicht hat und auch diesmal nicht erreichen wird, eventuell auch gar nicht erreichen will. Man denkt dabei vielleicht an die immer neuen, vergeblichen Anläufe des Sisyphos. Der in Latein und Altgriechisch bewanderte Stadler aber denkt an die Irrfahrten des Odysseus und an die ebenso sprichwörtlichen Pyrrhos-Siege, die sich als verkappte Niederlagen erweisen. Wie denn überhaupt antikes Bildungsgut die Wege säumt.
Freilich wird das Lamento bei der Suche nach einem Ort in der Welt auch mit Selbstironie gewürzt. Das erzählende Ich berichtet, es sei schon öfter „Hallodri“ oder auch „Schwadroneur“ genannt worden, macht sich aber nicht allzu viel daraus. Dieses Ich hat sich in einer doch recht komfortablen Außenseiterrolle jenseits des Tagesgeschreis eingerichtet und sagt sich, dass so viele nicht ihr eigenes Leben führen, sondern eines, wie es erwartet wird. Das schmeckt nach Wahrheit.
Aber nicht nur das Ich ergießt sich in mäandernder Suada, auch missliche Weltzustände kommen hervor, die einen durchaus resignieren lassen können. Auf der Textstrecke flottieren die Assoziationen frank und frei – von tagespolitischen Blitzlichtern und Melina Mercouris nostalgischem Schlager „Ein Schiff wird kommen“ (auch von vielen anderen gesungen, darunter Caterina Valente und Lale Andersen) über den legendären griechischen Milliardär Aristoteles Onassis (nebst Jackie Kennedy und Maria Callas) bis hin zu Sartre und Heidegger, Rudolph Moshammer und John Lennon. Um nur einige Beispiele zu nennen. Eine bunte Mixtur, fürwahr. Trotz solcher Wechselspiele wirkt der Duktus des Romans hin und wieder redundant und zuweilen etwas in sich selbst versponnen. Schon der Titel scheint ja zwischen Unschlüssigkeit und Entschiedenheit zu oszillieren.
Sodann die finale Schiffsfahrt über die Adria nach Triest. Schon zu Beginn war die Rede von einer Reise zum Kilimandscharo. Dieser Roman handelt jedoch ebenso sehr vom Bleiben und Beharren wie vom Unterwegssein und von Veränderung. Und immer wieder vom Allbezwinger Tod. Bereits 1996 war Arnold Stadlers auch hier wieder erwähntes Buch mit dem unvergesslichen Titel erschienen: „Der Tod und ich, wir zwei“.
Nun dieses bilanzierende Zitat gegen Schluss: „Ach! All meine Straßen und Wege und Holzwege. Doch war mein Leben nicht auch so etwas Schönes? Schön, weil es wahr war? Und wahr, weil es schön war trotz allem?“ So werden Resignation und Melancholie von der Abendsonne vergoldet. Irgendwie. Aber am Meer.
Arnold Stadler: „Irgendwo. Aber am Meer“. Roman. S. Fischer Verlag. 224 Seiten, 24 Euro.