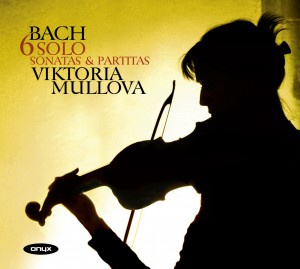Festival Alte Musik im rheinischen Knechtsteden: Beethoven im Licht seiner Lehrer und Zeitgenossen

Die Rheinische Kantorei und Das kleine Konzert. (Foto: Thomas Kost)
Offenbar kommt selbst ein Festival für Alte Musik in diesem Jahr nicht an Beethoven vorbei. Im rheinischen Knechtsteden organisiert Festivalleiter Hermann Max einen Beethoven-Abend, dessen Programmheft den pathossatten Titel „Nacht und Stürme werden Licht“ trägt.
Wer jedoch in der ehrwürdigen romanischen Basilika der ehemaligen Prämonstratenserabtei Knechtsteden auf dem Gebiet der Gemeinde Dormagen einen der üblichen Beethoven-Meisterwerk-Hommage-Abende erwartet, würde Hermann Max ziemlich unterschätzen: Der Leiter der Rheinischen Kantorei und des Barockorchesters „Das kleine Konzert“ erkundet „Beethovens Musikwelt“ in einem – mit zwei Pausen – mehr als dreistündigen Programm. Es leistet damit, was man sich andernorts öfter wünschen würde: Der „Ausnahme“-Komponist wird mit der „Regel“ des Komponierens seiner Zeit, mit Musik seiner Vorgänger, Zeitgenossen und Lehrer konfrontiert. Er verliert damit den Nimbus des Solitärs, wird aber in seinem einzigartigen Rang bestätigt, ohne dass alle anderen notwendigerweise ins Vergängliche oder gar in belanglose „Kleinmeisterei“ abgedrängt werden. Beethoven als einer unter anderen und doch nicht als einer wie alle anderen – das ist eine der Erhellungen des Programms.

Die romanische Basilika von Knechtsteden ist ein bedeutendes Zeugnis der Baukunst des 12. Jahrhunderts. Die ehemalige Prämonstratenserabtei ist heute Sitz des Provinzialats und des Missionshauses der Spiritaner. (Foto: Werner Häußner)
Die andere: Der in Wien zu monumentaler Größe herangewachsene Bonner ist nicht das einsame Genie, zu dem ihn eine nicht zuletzt nationalistisch beseligte Musikgeschichte stilisiert hat. Sondern er wurzelt in vielfältigen Traditionen; er saugt Einflüsse seiner Umwelt auf. Mehr noch: Bei ihm ist die Musik eine Kunst der Form und Ordnung, strebt aber nach Ausdruck, nach Aussage, sogar nach Überwältigung. In dieser Spannung spielt das Nachdenken über die Welt eine entscheidende Rolle – daher gilt Beethoven als „Philosoph“ unter den Komponisten, als der er sich wohl auch selbst verstanden hat.
Der „große Tonmeister oben“
Was im säkularisierten Kontext oft vergessen, verdrängt oder als marginales biographisches Beiwerk kaum beachtet wird: In diesem Nachdenken ist Gott, der „große Tonmeister oben“, ein unverzichtbarer Begriff, der Ausgangspunkt und das Ziel jeglichen Denkens. Dass Beethoven – wie sein sonst nicht immer zuverlässiger Biograph Anton Schindler wohl zutreffend sagt – nie über „Religionsgegenstände“ gesprochen habe, sein kirchliches Bekenntnis im nachjosephinischen Wien „gewissermaßen eingeschlummert“ sei, bedeutet für den Denker Beethoven nicht viel. Ob er weniger gläubig war als etwa der eifrig praktizierende Anton Bruckner, lässt sich am Mangel an frommer Verrichtung jedenfalls nicht entscheiden.
Ist Beethovens geistliche Musik also weniger „geistlich“ als etwa die Messen Bruckners oder Haydns? Martin Geck kommt in seinem brillanten Beethoven-Buch zu einem anderen Ergebnis. Er betont den Wert religiöser Autoren wie Christoph Christian Sturm („Betrachtungen über die Werke Gottes im Reiche der Natur und der Vorsehung auf alle Tage des Jahres“) und Johann Michael Sailer, dessen „Goldkörner der Weisheit und Tugend. Zur Unterhaltung für edle Seelen“, vor allem aber die Übersetzung der „Nachfolge Christi“ des Thomas von Kempen prominente Lektüre Beethovens waren. Der immer wieder angefeindete Sailer, ab 1829 Bischof von Regensburg, ist nach Geck eine „zentrale Figur in der inneren Welt Beethovens“.
Lächerlich und geschmacklos?

Hermann Max gründete das Festival im Jahr 1992. (Foto: Werner Häußner)
Der Komponist versucht vor allem in seiner „Missa solemnis“ op. 123, aber auch bereits in seiner C-Dur-Messe op. 86, sich der liturgischen Form unterzuordnen, aber gleichzeitig persönliche Betroffenheit und religiöse Erfahrung auszudrücken. Hermann Max demonstriert diesen innovativen Ansatz Beethovens mit seiner Rheinischen Kantorei am letzten Abschnitt der C-Dur-Messe, dem „Agnus Dei“: Fast zum Verzweiflungsschrei wird das Forte auf „Dei“ in der eröffnenden Anrufung, düster drückt der Bass die Welt in die Tiefe („peccata mundi“). Der Kontrast des flehentlich gesteigerten „miserere nobis“ zum milden piano des „dona nobis pacem“ ist geschärft, die Bitte um Frieden mit der nötigen Emphase ausgedrückt. Max macht mit seinen Sängern deutlich, wie Beethoven jedes Wort des Textes mit Ausdruck belegt. Dem Auftraggeber, dem Fürsten Nikolaus II. Esterházy, hat die mit großem Ehrgeiz komponierte Messe – Beethoven musste sich ja dem achtunggebietenden Vorbild Haydn stellen – nicht gefallen; er fand sie lächerlich und geschmacklos.
Warum das harte Urteil? Beethoven hatte ganz im Sinne damals modernen liturgischen Denkens das Wort sorgsam behandelt, ohne die musikalische Form aus dem Blick zu verlieren – er selbst sagt, er habe den Text behandelt, „wie er noch wenig behandelt worden“. Die Tradition, derer sich Beethoven bedient, erklang in dem Konzert mit dem „Kyrie“ aus der Messe A-Dur Johann Sebastian Bachs – in der Weite der Knechtstedener Basilika gesungen in wundervoll reiner Intonation – und im „Crucifixus“ der h-Moll-Messe, deren expressiven ostinaten Bass Hermann Max‘ Orchester kraftvoll, aber nicht ruppig intoniert – und damit zeigt, wo die Wurzeln von Beethovens Ausdrucks-Musik liegen.
Ein anderes Beispiel liefert Johann Philipp Kirnbergers „Erbarm dich, unser Gott“, in dem das Wort „Gott“ ähnlich wie im „Agnus Dei“ der Beethoven-Messe ein beschwörender Aufschrei ist. Antonio Salieris „Salve Regina“ mit seinem harmonisch-sanglichem Satz spiegelt die flehentliche Süße des „dona nobis pacem“ wieder. Als Kontrast darf die „Missa Sancti Huberti“ von Johann Ries gelten: Deren „Sanctus“ ist aufklärerisch in seinen leicht fasslichen Harmonien und dem Verzicht auf kontrapunktischen Ehrgeiz, gibt dem Sopran Kerstin Dietl dankbares Material, um die Stimme leuchten zu lassen, und erfüllt wie das Klavierquintett op. 74 seines Sohnes und Gefährten Beethovens Ferdinand Ries sehr gekonnt die Form, ohne ihre Grenzen zu sprengen.
Pathos und Dramatik
Spannend auch die Begegnung mit Christian Gottlob Neefe. Nach Einschätzung der Beethoven-Spezialistin Julia Ronge wird er als Lehrer des jungen Louis zwar überbewertet, wie sie in einem der Gesprächseinschübe zwischen den drei Musikblöcken des Konzerts kundtat. Doch zeigt sich Neefe in der Szene „Der Regen strömt, der Sturm ist erwacht“ als treffsicherer Dramatiker, dessen erregte Klavierfiguren Tobias Koch auf einem Hammerflügel der Beethovenzeit aus der Werkstatt des Wieners Conrad Graf mit passender Bravour aufschäumen lässt.
Auch ein Ausschnitt aus Johann Nepomuk Hummels Oratorium „Der Durchzug durchs Rote Meer“ aus dem Jahr 1806 gibt ein Zeugnis davon, wie Pathos und Expression in die Musik der Zeit Einzug gehalten haben: Der Donner rollt, die Blitze zucken und die Musiker von „Das kleine Konzert“ haben hörbar Freude daran, diese auf Carl Maria von Weber vorausweisenden Klänge zu befeuern. Andreas Post singt den „Würg’engel“ in unheimlich engen chromatischen Schritten mit einer unfehlbar sitzenden, schneidenden Stimme. Und wenn am Ende die Pauke aufrollt, meint man, die musikalische „Mahlerey“ eines Abbé Georg Joseph Vogler zu vernehmen, jenes avancierten Musiktheoretikers, dessen Verhältnis zu Beethoven bisher kaum beleuchtet wurde.
Die über drei Stunden dieser langen Konzertnacht verflogen im Nu und bereicherten mit einer Fülle musikalischer Eindrücke, die das Phänomen Beethoven mit treffsicher ausgewählten Schlaglichtern überraschend und aufschlussreich beleuchteten.