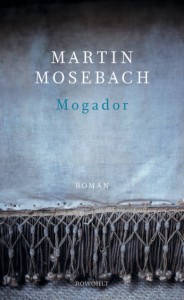Wok-Gemüse! Oder: Zeitdiebe lauern überall
Nicht überall treten Zeitdiebe so auf wie die grauen Herren in Michael Endes Roman „Momo“. Hierzulande sind es meist profitsüchtige Unternehmen und ihre Handlanger, die nur allzu gern die Zeit ihrer Kunden stehlen, um damit eigene Arbeitszeit einzusparen oder vermeintlich zu teures Personal abzubauen. Der Kunde ist König? Pah! Das war einmal. Kunden von heute sind vor allem eins: Nützliche Idioten, fest eingeplant, um gefälligst Dienstleistungen für jene Firmen zu erbringen, deren oberster Glaubenssatz lautet „Your time is our money!“
Wenn man vom Teufel spricht: Hermes ist kein Götterbote
DHL, UPS, DPD, HERMES …: Ich bin bekennender Onlinehandel-Verweigerer – nutzt aber nichts. Im schlimmsten Falle klingeln an einem einzigen Tag gleich mehrere Paketdienste und reißen mich aus Arbeitsflow oder Ruhepuls. Immer neue Kartons für die Nachbarn (auch auf der anderen Straßenseite) würden die uniformierten Boten gerne bei mir zwischenlagern. Gänzlich unbezahlt soll ich so die Lieferkette für Firmen mit Milliardenumsätzen vervollständigen.
Mittlerweile frage ich über die Gegensprechanlage, für wen denn die Sendung bestimmt sei und nehme nichts an, es sei denn, Freunde oder Kollegen schickten uns etwas Gutes. Besonders dreist: Die Paketfahrer bestehen bei der Annahme einer Sendung für Dritte auf einer Unterschrift – womit sie aus der Haftung raus wären und ich irgendwie drin.
Am Gängelband: Please hold the line!
Wer kennt das nicht? „Zurzeit ist leider kein Kundenberater frei, die Wartezeit beträgt voraussichtlich 17 Minuten.“ Spätere Anrufe werden ähnlich abgefertigt. Glücklich, wer an ein Unternehmen gerät, das einen Rückruf anbietet. Doch auch das kann dauern und man muss in der Nähe des Telefons bleiben, sozusagen im Stand-by-Modus, damit das Unternehmen selbst bei geringstem eigenen Personalaufwand wie geschmiert agieren kann. Ob der Kunde aus dem Takt kommt oder gestört wird? Zählt doch nicht.
Termin-Vereinbarungen: Pünktlichkeit ist eine Zier …
Besonders viel Zeit muss sich nehmen lassen, wer auf Handwerker oder Wasseruhr-/Strom-/Heizungs-Ableser wartet. Diese Freibeuter gehen schlicht davon aus, dass der Kunde sich einen halben oder ganzen Tag Urlaub nimmt, um dem frei flottierenden Arbeitsmanne ein schön großes Zeitfenster offenzulassen, durch das er dann zur Tür hereinkommt. Zeitangaben wie „Unser Mitarbeiter wird Sie in der Zeit von 10 – 16 Uhr zu erreichen versuchen“ sind keine Seltenheit. Wenn man besonderes Pech hat, kommt der Mitarbeiter sowieso nicht und die Zentrale des Unternehmens schlägt einen zweiten Termin vor, der diesmal aber kostenpflichtig sei, weil man ja beim ersten Termin nicht anzutreffen war? Wie bitte?
Rottweiler und kölscher Klüngel
Damit die Banken noch mehr Personal einsparen und Filialen schließen können, hatte die Rottweiler Sparkasse eine die Unternehmensressourcen langfristig schonende Idee: „Die Kreissparkasse Rottweil bietet zu verschiedenen Terminen kostenlose Schulungsnachmittage für neue Online-Banking-Teilnehmer an.“
Die Sparkasse KölnBonn ist da kundenorientierter und beglückt ihre Onliner in spe immerhin in der Eingeborenensprache: „Die Sparkasse (…) macht das Online-Banking kölsch. In Zeiten, in denen durch Online-Banking Besuche in der Filiale vor Ort und das Schwätzchen op Kölsch mit den Angestellten immer seltener werden, bringt die Sparkasse damit ein Stück Kultur in ein neues Zeitalter. Umsatzabfrage heißt auf kölsch Ömsatzavfrog (…). Kölsch-Fans können seit dem 1. Dezember ihre Online-Bankgeschäfte in der Sprache machen, ‚die mer’n Düsseldorf zwar Rheinisch, doch em Rest der Welt Kölsch nennt‘ – wie schon BAP sang.“
Wenn dann der Kunde am Ende seinen PC, sein Telefon, seinen Strom und seine Zeit nutzt, um Buchungen anstelle der Sparkasse durchzuführen, dann geht ihm vielleicht doch noch auf: „Ich han zwei Arm för ze arbeide, zom Jlöck ävver och zwei Bein för dr Arbeit us dem Wääch ze jon.“
Arztpraxen: Die Dosis macht das Gift
Da merkt man doch gleich, dass die Halbgötter in Weiß immer noch eine Sonderstellung einnehmen. Wie sonst nur bei Gericht verschwendet man in deutschen Wartezimmern ganze Tage mit der Lektüre der Regenbogenpresse, mit angenehmen Gesprächspartnern im Austausch über Hämorrhoiden oder Zahnstein. Gern auch im Stehen, weil’s Wartezimmer schon voll ist. Man kam ja wegen des Rückens, da sollte man einmal gezielt in den Lendenbereich hineinspüren, bevor sich der Doc drei Minuten Zeit nimmt („Jaja, die Budgetierung …“), um eine Anstaltspackung Ibuprofen 800 zu verschreiben.
Patienten zur Verfügung
Meine Frau musste sich einer Fuß-OP unterziehen. Zuvor gab’s einen OP-Vorbereitungstag, einen Staffellauf für Masochisten, eine Art Aufnahme-Hindernisparcours. Eine Station bildete das Aufklärungsgespräch beim Narkose-Doc. Leider war der an dem Morgen aber auch als Notarzt eingeteilt. Die Patienten fanden sich also brav ab 9.30 Uhr ein, um auf die Sprechstunde zu warten, die dann aber erst ab 12.30 Uhr begann und nur eine knappe Stunde dauerte, weil der Betäubungsspezialist als Notarzt wieder ausrücken musste. Ich vermute, dass einige Patienten im Bergmannsheil GE-Buer (als Mitbewerber um eine OP) mittlerweile mumifiziert keinerlei Narkose mehr benötigen.
Unter allen Häubchen nur Geflügelformfleisch
Meine Frau hatte Glück. Ihr Gespräch fand um 13 Uhr statt. So viel Fortune muss aber auch bestraft werden. Das geschah dann am OP-Tag selbst, als sie sich um 7.30 Uhr einzufinden hatte, um erst gegen 11 Uhr Zimmer und Bett zugewiesen zu bekommen. Schön, dass sie während der Wartezeit in einer Sitzecke auf ungastlichem Flur (sie ist übrigens Privatpatientin!) an diesem Donnerstagmorgen doch noch Besuch bekam – von einer Diätassistentin. Für Freitagmittag wurde überlebens-optimistisch Wok-Gemüse bestellt.
Am Freitag kam tatsächlich auch ein Tablett mit einem Laufzettel, „Wok-Gemüse“ stand drauf. Hob man aber die Plastikhaube vom Teller, schwamm da ein aufgeweichtes Geflügelschnitzel in reichlich Tomatensauce, dazu Reis. Ich bin dann für meine Frau zu den Damen der Essensauslieferung geeilt. Dort beschied man mich, dass wir wohl zu spät oder vielleicht das Falsche bestellt hätten. Dieser Irrtum konnte ausgeräumt werden. Schnell wurde auf dem Transportwagen nach einem anderen Tablett mit Wok-Gemüse-Laufzettel gesucht und siehe da, es gab derer noch einige. Unser Pech: Unter allen Häubchen nichts als Geflügelformfleisch in Tomatenbad. „Da ist wohl einiges schiefgelaufen …“, hieß es schon kleinlauter. Immerhin, oft hört man bei solchen Gelegenheiten sonst nur den Satz: „Da sind Sie aber der Erste, der sich beschwert.“
Jedenfalls gab’s an dem Tag kein Mittagessen mehr für meine Frau. Ich bin dann ab in die Cafeteria, um in einer langen Schlange allmählich zur Essensausgabe vorzurücken. Und was gab es da Herrliches für Gäste und Angestellte? Unter anderem: Wok-Gemüse! Frisch aus der China-Schüssel! Vom Chef selbst geschwenkt.