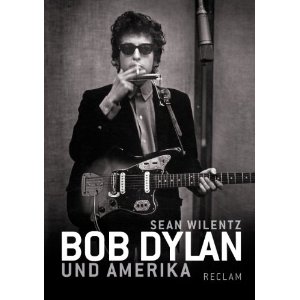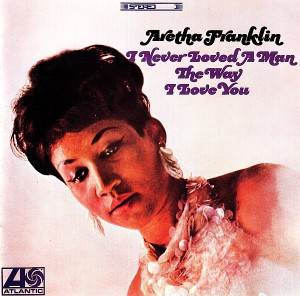„Ein leuchtender Teil Amerikas“ – Zum 80. Geburtstag von Bob Dylan

Ein geradezu ikonenhaftes Bild aus den alten Zeiten: Bob Dylan mit Joan Baez, am 28. August 1963 beim Civil Rights March nach Washington, D. C. (Foto: Rowland Scherman / U. S. National Archives and Records Administration / gemeinfrei – public domain)
Das Fachmagazin „Rolling Stone“ listet Bob Dylan auf Platz 2 der „größten Musiker“ und auf Platz 1 der „bedeutendsten Songwriter aller Zeiten“. Mit seiner Musik und Poesie hat er Generationen begleitet und geprägt.
Manchen gilt er als Friedensapostel, anderen als Bürgerschreck. Doch für Bob Dylan, der am 24. Mai 1941 als Robert Allen Zimmerman in Duluth/Minnesota geboren wurde, gibt es keine passende Schublade. Er macht, was ihm gefällt, ist nie da, wo man ihn vermutet. Während andere Künstler sich zur Ruhe setzen, ist Bob Dylan, der als erster Musiker den Literaturnobelpreis bekam, seit Jahren auf einer „Never Ending“ Konzert-Tour“. Zum 80. Geburtstag erscheinen zwei Bücher, die sein Leben und Werk würdigen: „Look Out Kid“ und „Forever Young“.
Immer wieder ins Grübeln kommen
„Look Out Kid“ ist eine mehrfach wiederholte Zeile aus dem Song „Subterranean Homesick Blues“. In diesem „Unterirdischen Heimweh-Blues“ werden seltsame Gefahren zu einem Alptraum vermengt, die Zuhörer werden immer wieder gewarnt: „Look Out Kid“, Pass auf! Sieh dich vor! Sei vorsichtig, sonst bekommst du Prügel! So wie mit diesem surrealen Song geht es oft: Man kommt bei den Liedern immer wieder ins Grübeln, erklärt sie sich immer wieder anders, wird sie nie richtig verstehen, bekommt sie aber nicht aus dem Kopf. Deshalb hat Autor Maik Brüggemeyer einige Kollegen gebeten, sich einen Song von Dylan auszusuchen, der sie seit langem begleitet, verzaubert, ärgert. Entstanden sind Texte, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Bekenntnisse, Reiseberichte, Reportagen, Erzählungen, eine Dylan-Hommage mit 20 verschiedenen Stimmen.
Stefan Aust und Martin Scholz gehen einen anderen Weg, um Zeitlosigkeit und Unsterblichkeit von Dylan zu beweisen: Den Song „Forever Young“ kennt jeder, und „Für immer jung“ bleibt Dylan für viele Musiker, Schriftsteller, Politiker, die berichten, warum sie nicht von seinen Liedern lassen können. Zu ihnen gehören T. C. Boyle, Patti Smith, Joan Baez, aber auch Otto Schily und Ursula von der Leyen.
Eine Mundharmonika für Nicolas Sarkozy
Kaum zu glauben: aber Ursula von der Leyen, die ja heute als Inbegriff der garantiert knitterfreien Politikern gilt, hatte früher eine wilde Seite, mit einem kleinen Fiat 500 düste sie durch Europa und hörte dabei gern ihre Lieblings-Songs von Dylan, „Just Like A Women“, „Blowin´ In The Wind“, Lieder, die sie noch heute gern laut singt. Besonders schätzt sie, dass Dylan Fragen stellt, ohne gleich Antworten zu geben, dass er Menschen zum Nachdenken bringen kann und „meiner Generation geholfen (hat), Kritik öffentlich auszusprechen, einfach mal durchzuatmen“.

Bob Dylan im Juni 2010 beim Akzena Rock-Festival in Vitoria- Gasteiz, Spanien (Baskenland, bei Bilbao). (Foto: Alberto Cabello / Wikimedia Commons – Link zur Lizenz)
Otto Schily, Mitbegründer der Grünen und späterer SPD-Innenmister, bewundert Dylan als Protagonisten des permanenten Wandels und der Skepsis: „Dylan repräsentiert für mich den Umbruch wie kein anderer“. Die Sängerin Carla Bruni berichtet, wie sie mit ihrem Gatten, Nicolas Sarkozy, nach einem Dylan-Konzert in Paris in die Garderobe gebeten wurde und einen linkischen und schüchternen Dylan erlebte, der zum Abschied Sarkozy seine Mundharmonika schenkte: „Die habe ich sofort an mich genommen“, lacht Carla Bruni. Was auch soll ihr künstlerisch unterbelichteter Mann mit dieser Reliquie eines musikalischen und poetischen Gottes anfangen? So kurzweilig erzählen sie alle von ihren Begegnungen mit Dylan: Für Navid Kermani ist Dylan „ein leuchtender Teil Amerikas, an den man glauben möchte“, und T. C. Boyle, der in seinen Romanen oft musikalische Fährten legt, meint: „Ich höre jeden Tag Bob Dylan, eigentlich höre ich ihn den ganzen Tag.“
Plötzlich die E-Gitarre eingestöpselt
Im Song-Book von Maik Brüggemeyer erfährt man, wie Frank Goosen sich an seine Kindheit und an den Song „It´s All Right Ma (I´m Only Bleeding)“ erinnert, den er bis heute zwar nicht kapiert, aber mit dem langhaarigen Studenten verbindet, der damals im Hause seiner Eltern ein Zimmer unterm Dach bewohnte, ständig Dylan hörte, halbnackte Frauen fotografierte und von seiner Verwandtschaft für einen RAF-Terroristen gehalten wurde.
Tom Kummer erfindet eine Geschichte rund um die Aufnahmen des vielleicht bedeutendsten Albums, „Highway 61 Revisited“ (1965): Dylan verschreckt seine Folk-Fans plötzlich mit E-Gitarren-Rock und spielt Songs für die Ewigkeit: das vom Alleinsein handelnde „Like A Rolling Stone“ und „Ballad Of A Thin Man“, die Ballade vom dünnen Mann, Mr. Jones, dem spießigen Jedermann, der spürt, dass sich irgendwas ändert und vorgeht, der aber nicht weiß, was es ist und soll. Ein visionäres Lied, zu dem sich Tom Kummer eine aberwitzige Geschichte ausgedacht hat, die die Atmosphäre der damals aufgeheizten politischen Zeit einfängt. Enttäuschend dagegen die Geschichte, die sich Benedict Wells zum Song „I´m Not There“ hat einfallen lassen: nämlich gar keine! Durch seinen Kopf rauschen unzählige Gedanken, die er nicht recht fassen kann, deshalb beschließt er, „dass die vielleicht aller-dylanesqueste Weise, über Bob Dylan zu schreiben, ist, nicht über ihn zu schreiben. Sondern ihm nur kurz von Straßenrand aus zuzunicken, während schon die Hand des Lesers kommt, diese Seite umzublättern.“
Wer nach der vielstimmigen Dylan-Hommage den Meister im Original lesen möchte, sollte die Autobiographie aufschlagen, „Chronicles“, die sich wie ein kurzweiliger, spannender Roman liest. Außerdem: „Best Of Lyrics“, eine Zusammenstellung (auf Englisch und Deutsch) von 111 Songs, über die Dylan in seiner Rede zum Literatur-Nobelpreis sagte: „Sie sind etwas anderes als Literatur. Sie sollen gesungen, nicht gelesen werden. So wie die Worte in den Dramen von Shakespeare auf der Bühne gesprochen werden sollen, so sollen die Texte von Songs gesungen werden und nicht auf einer Buchseite gelesen.“ Holen wir also am besten die alten Schallplatten und neuen CDs aus dem Regal, singen wir einfach mit und spüren, wie befreiend das sein kann!
Maik Brüggemeyer (Hrsg.): „Look Out Kid“. Bob Dylans Lieder, unsere Geschichten. Ullstein Verlag, Berlin 2021, 272 S., 18 Euro.
Stefan Aust / Martin Scholz: „Forever Young“. Unsere Geschichte mit Bob Dylan. Hoffmann und Campe, Hamburg 2021, 288 S., 22 Euro.
Die „Chronicles“ sowie „Best of Lyrics“ sind bei Hoffmann & Campe erschienen.
_________________________________
Hier zur Ergänzung noch ein Link zum Beitrag, der bei den Revierpassagen vor fünf Jahren zu Bob Dylans 75. Geburtstag erschienen ist.