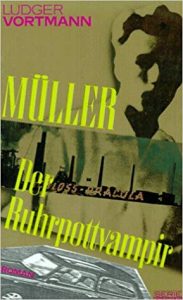Das träufelnde Gift der Bitterkeit – Der Singer-Songwriter Vic Chesnutt im Bochumer „Bahnhof Langendreer“
Von Bernd Berke
Bochum. Im Live-Konzert finden viele Rockfans eine technische Perfektion wie aus dem Plattenstudio selbstverständlich. Lebendig soll’s aber trotzdem wirken. Der Singer-Songwriter Vic Chesnutt (35) aus Athens/Georgia (USA) durchbricht derlei Erwartungen wie kein Anderer.
Beim Start seiner Deutschland-Tournee im Bochumer „Bahnhof Langendreer“ spürt man vor allem anfangs, welch eine fragile Angelegenheit ein solcher Auftritt sein kann. Chesnutt stimmt einen fast tonlosen Singsang an und „schrammelt“, als spiele er nur so für sich; vielleicht auf einer Veranda unterm Sternenhimmel, irgendwo weit draußen.
Man fürchtet, dieser überaus Empfindliche könne sich im nächsten Moment einer namenlosen Einsamkeit überlassen und unvermittelt abbrechen. Kommt es zum Fiasko? Nein. Allmählich, vielfach stockend, findet er ins Jetzt und zum Publikum.
Seine Frau Tina, für ihre ungeheure Langsamkeit berüchtigte Bassistin, ist erkrankt. Also bleibt der Mann im Rollstuhl (schwerer Verkehrsunfall im Suff mit 18 Jahren) heute auf sich gestellt.
Seine Konzerte sind nicht etwa „Reha-Maßnahmen“, die man mitleidig und schonend besprechen müsste, sondern intensive Ereignisse von ganz eigener Art. Überregionale Feuilletons sind jüngst hellhörig geworden. Desgleichen Stars wie Madonna oder die Smashing Pumpkins, die Kompositionen von ihm spielten. Als Songschreiber ist Chesnutt eine Größe und kann längst aus breitem Repertoire schöpfen. In Bochum stimmt er zerbrechliche Kostbarkeiten wie „Betty Lonely“, „Westport Ferry“ und „I Ain’t Crazy Enough“ an.
Allein rollt er also auf die Bühne, zwei Gitarren (eine elektrische, eine verstärkte akustische) und eine Mundharmonika warten in Reichweite. Chesnutt, der zuweilen (zwischen verlegenem Charme und zynisch-obszönen Anwandlungen) mit seinem Handicap kokettiert, schlägt die Saiten mit einem Plektrum an, das auf eine Art Handschuh geklebt ist.
Daraus ergibt sich ein Stil, der etwa Bob Dylan manchen Impuls verdanken mag, sich aber unverkennbar abhebt. Scheppernd und schleppend kommen die Akkorde. Musik der tastenden Ungewissheit und des Zögerns, mit sprachlich ausgefeilten, zuweilen „rabenschwarzen“ Texten, vorgetragen mit gepresster, brüchiger Stimme, die sich kaum einmal Luft verschafft. Träufelndes Gift der Verbitterung.
Und manchmal gibt’s Saiten-Hiebe wie wütende Attacken, als bräche ein Hass auf alle Welt sich Bahn, der dann doch – von sich selbst erschrocken – wieder innehält. Auf den CDs verhüllen Nachbearbeitung und Begleitbands den Rohzustand dieser Musik, die sich jedoch in ungeahnt zartsinnige Sphären untröstlicher Melancholie und unstillbarer Sehnsucht zu erheben vermag.