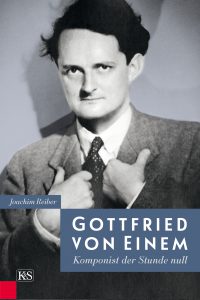„Kreativität aus der Krise“: Manuel Schmitt über seine Revier-Herkunft und seine Inszenierung von „Romeo und Julia“

Szenenfoto aus Boris Blachers „Romeo und Julia“ auf der Bühne des Theaters Duisburg. Foto: Hans Jörg Michel
Es ist eine der faszinierendsten Liebesgeschichten der Weltliteratur: Zwei junge Menschen aus seit Generationen verfeindeten Familien, eine verbotene Liebe auf den ersten Blick, eine schwärmerische Liebesnacht und der Tod nach tragischer Verkettung glückloser Umstände. „Romeo und Julia“ erschüttert bis heute mitfühlende Seelen.
Kein Wunder, dass der Stoff vielfach in Musik gefasst wurde: Allein über 40 Opern werden gezählt. Die bekanntesten Vertonungen stammen von Vincenzo Bellini („I Capuleti e i Montecchi“) und von Charles Gounod (kürzlich an der Deutschen Oper am Rhein und in Aachen neu inszeniert). Ein kaum bekanntes Juwel verfasste Riccardo Zandonai („Giulietta e Romeo“), andere stammen von Heinrich Sutermeister oder dem Bellini-Zeitgenossen Nicola Vaccai.
Für einen an Corona adaptierten Spielplan hatte die Deutsche Oper am Rhein (Düsseldorf/Duisburg) eine Version aus dem 20. Jahrhundert ausgewählt: Im November 2020 sollte Boris Blachers „Romeo und Julia“ Premiere feiern, inszeniert von Manuel Schmitt, der vor zwei Jahren in Gelsenkirchen mit Georges Bizets „Die Perlenfischer“ einen markanten Erfolg landen konnte. Allein – dazu kam es nicht; der Herbst-Lockdown machte eine Live-Aufführung der fertig geprobten Oper unmöglich. Jetzt wird sie wenigstens medial nachgeholt: Ab Samstag, 17. April, 19 Uhr, streamt die Deutsche Oper am Rhein die Produktion, aufgezeichnet im März im Theater Duisburg.
Corona-Lockdown und Wasserschaden

Der Regisseur Manuel Schmitt. Foto: Esther Mertel
Für Manuel Schmitt, der in Mülheim/Ruhr aufgewachsen ist, ein Grund zur Freude. Denn die Pandemie hat den 32-Jährigen in einer wichtigen Phase seiner Karriere voll erwischt. In der Zeit seit März 2020 hätte er in den Münchner Kammerspielen, an der Oper Frankfurt und erneut am Musiktheater im Revier vier wichtige Premieren gehabt. Einen Tag vor der Premiere von Heinrich Marschners „Der Vampyr“ im sächsischen Radebeul wurde der erste Lockdown verkündet. Und seine Inszenierung einer selten gespielten Oper des Italieners Saverio Mercadante nach Schillers „Die Räuber“ in Hildesheim musste im September 2020 nach der Premiere wegen eines Wasserschadens abgesetzt werden. Trotzdem sagt Manuel Schmitt, es gehe ihm eigentlich noch ganz gut: „Ich bereite zuhause meine Produktionen vor und konnte bisher einen Teil der geplanten Proben abhalten. Daher bin ich vielleicht noch in einer vergleichsweise glücklichen Position.“
„Hier hängt mein Herz“
Schmitt bezeichnet sich selbst als „Kind des Ruhrgebiets“: „Hier hängt mein Herz“, sagt der junge Regisseur mit derzeitigem Wohnsitz in München. „Im Rhein-Ruhr-Gebiet zu arbeiten, ist toll“. Zwar steht in seinem Ausweis Oberhausen als Geburtsort, aber Schmitts Heimat ist Mülheim. Ein mit klassischer Musik groß gezogenes Bildungsbürgerkind ist er nicht. Er wuchs in einer Familie auf, die eher zu technischen Berufen hin orientiert ist. Doch sein Interesse für Musik wurde noch vor der Grundschule geweckt und zunächst im Klavierspiel ausgelebt. Ein einschneidendes Erweckungs-Erlebnis gab es nie: Der kleine Manuel ging zwar mal in „Hänsel und Gretel“, aber an die Begeisterung über Engelbert Humperdincks Oper erinnert sich nur noch die begleitende Patentante.
„Mit Zehn ging’s dann los“, blickt Schmitt zurück. Aus heiterem Himmel kam ein Casting zum Musical „Tabaluga & Lilli“ mit Peter Maffay in Oberhausen. „Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, hab‘ aber dann zwei Jahre mitgespielt.“ Der Theater-Virus wirkte: Manuel Schmitt erschnupperte in Essen „die völlig neue Welt der Oper“. Er hospitierte am Aalto-Theater, war dort Statist, assistierte unter anderem bei Willy Decker bei der Ruhrtriennale, erinnert sich an eine ihn faszinierende „Aida“ in Gelsenkirchen. Am Aalto hat er auch gemerkt, „was es für einen Drive hat, mit Leuten wie Hans Neuenfels oder Barrie Kosky zu arbeiten. Ohne diese Erfahrung wäre ich meinen Weg nicht gegangen.“
Dazwischen lag eine Ruhrgebiets-Jugend zwischen Mülheim, Oberhausen und Essen und das Abitur am Gymnasium Heißen: „Vier U-Bahn-Stationen, und man hat alles um sich rum“, schwärmt Schmitt, „ob einen Rückzugsort im Wald oder eine heiße Party.“ Er schätzt die offenen Menschen, das multikulturelle Umfeld, den hohen Stellenwert von Kultur. „Ich glaube an das Potenzial des Ruhrgebiets: Hier gibt es die Menschen, den Raum, die Innovation.“
Regie und Philosophie
Als einer von zweien bestand er die Aufnahmeprüfung an der Münchner Bayerischen Theaterakademie, benannt nach August Everding, einem gebürtigen Bottroper. 2013 schloss er sein Regiestudium mit einer Inszenierung von Philip Glass‘ „Galileo Galilei“ ab. Danach, um tiefer zu blicken, folgte noch ein Philosophie-Studium an der Hochschule für Philosophie der Jesuiten in München.

Manuel Schmitt bei einer Probe von „Romeo und Julia“. Foto: Esther Mertel
Dass er nun eine unbekannte Oper von 1943 mit einem Weltliteratur-Thema inszeniert hat, macht ihm „großen Spaß“. Boris Blacher, ein in China geborener Kosmopolit, 1975 in Berlin gestorben, hat keinen Blockbuster geschrieben, sondern den Stoff von Romeo und Julia auf seine Essenz konzentriert. Damals durch den Krieg, heute durch die Pandemie, sind die Möglichkeiten, große Oper zu spielen, begrenzt. Blacher hat sein Werk den Umständen der Zeit angepasst: Eine gute Stunde Spieldauer, neun Musiker, zwei Hauptrollen, der Rest kann aus dem kleinen Chor besetzt werden. Ideal also für einen an Corona angepassten Spielplan.
Blachers Musik gibt sich akribisch konstruiert und völlig unromantisch, erreicht aber mit einem „Minimum an Mitteln ein Maximum an Wirkung“, wie der Kritiker Hans Heinz Stuckenschmidt schrieb. Die strenge, rhythmisch betonte Schreibweise erinnert an Paul Hindemith, aber auch an den Esprit der französischen Sachlichkeit eines Darius Milhaud. Zusätzlich gebrochen wird die Handlung – streng nach Shakespeare, aus dessen Drama Blacher den Text destilliert hat – durch einen Chansonnier: Der singt einen Prolog und zwei Songs nach Art von Kurt Weill, die bezeichnenderweise bei der offiziellen Uraufführung der Oper in Salzburg 1950 weggelassen wurden.
Ein pazifistisches Werk
Bemerkenswert für Manuel Schmitt ist, dass Blacher seine Oper mitten in der Kriegszeit auf einen Text des Engländers Shakespeare geschrieben hat und mit einem Friedensappell beginnen lässt: „Zu Boden werft, bei Buß‘ an Leib und Leben, die mißgestählte Wehr aus blut’ger Hand“, singt der Chor am Anfang. „Heute ist schwer herauszulesen, dass die Oper unter den damaligen Umständen ein pazifistisches Werk war“, ist sich Schmitt sicher. Blacher lasse sie auch nicht mit dem Tod der Liebenden enden, sondern reflektiere die Auswirkungen der Liebe. Für Schmitt eine positive Auswirkung der Krise: Statt der üblichen „großen“ Opern erlebten Werke eine Renaissance, die vorher unbeachtet geblieben seien oder die man sich nicht zugetraut habe. „Wir schlagen Kreativität aus der Krise.“
Schmitt stört es überhaupt nicht, dass er derzeit eher unbekannte Opern – wie die von Mercadante, Marschner oder jetzt Blacher – inszeniert. „Publikum und Ausführende schauen unbelastet auf diese Stoffe. Wir können frei von Erwartungen und Sehgewohnheiten die Stärken und Schwächen solcher Werke aufdecken. Man wächst an den Vorlagen. Und ich bin sicher, dass die Krise ästhetisch und in den Spielplänen Spuren hinterlassen wird.“ So freut sich der Theatermann, dass er seine nächste große Herausforderung in Gelsenkirchen bestehen kann: Dort soll er demnächst Gioachino Rossinis Oper „Otello“ proben. Das bedeutet für ihn absolutes Heimatfeeling: „Wenn ich sage, ich gehe nach Hause, dann meine ich das Ruhrgebiet.“
Die Online-Premiere von „Romeo und Julia“ am Samstag, 17. April 2021, 19 Uhr, wird von einem Live-Chat mit Regisseur Manuel Schmitt und Dramaturgin Anna Grundmeier begleitet. Danach ist das Stück für sechs Monate – bis 17. Oktober – kostenfrei online abrufbar. Unter der musikalischen Leitung von Christoph Stöcker wurde es am 18. und 19. März aus sechs Kameraperspektiven im Theater Duisburg aufgezeichnet.
Weitere Informationen zur Inszenierung hier und zum Stream auf www.operamrhein.de