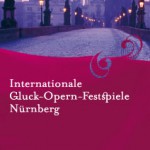Verdorrter Wald, zutiefst gespaltene Welt: Carl Maria von Webers „Freischütz“ am Theater Münster

Entwurzelter Baum, entwurzelte Existenzen: Mirko Roschkowski als Max und – im Hintergrund – Gregor Dalal als Kaspar in Webers „Freischütz“. (Foto: Oliver Berg/Theater Münster)
Rotgraue narb‘ge Wurzeln strecken nach uns die Riesenfaust: Ein gewaltiger Baum beherrscht die Bühne des Theaters Münster. Er ist entwurzelt, hat im Fallen eine Bresche in einer Mauer geschlagen und zerteilt die Einheit des Raumes. Neblige Dunkelheit, der Schatten eines stattlichen Sechzehnenders taucht auf. Lautlos röhrt der Hirsch zur Ouvertüre.
Die Bühne von Christophe Ouvrard für Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ nimmt von Anfang an für sich ein. Die unheimlich ragenden Wurzeln des Baumriesen, das harte Licht von oben und hinten, das die Konturen gespenstisch belebt, der unfassbar tiefe, in Nichts mündende Raum. Ouvrard arbeitet mit szenischen Mitteln, die zum Naturalismus taugen könnten, aber sofort assoziativ gebrochen, mit symbolischer und metaphorischer Brisanz geladen werden: Natürlich erinnert der Baum an den deutschen Wald, der in Webers „Freischütz“ eine so große Rolle spielen soll. Aber er ist – vielleicht von einem Sturm des „wilden Heeres“ – gefällt und tot. Nur einmal sprießen aus der Baumleiche ein paar frische Zweige, grüne Blätter: O lass‘ Hoffnung …
Dieser verdorrte Wald ist schon lange kein Hort naturschwärmerischer Romantik mehr. Er ist der Ort des Unheimlichen, das die frühere Einheit der Welt zerschlagen hat. Auf der Drehbühne wird das sichtbar: Der Stamm teilt sie in zwei Hälften. In der einen steht die Welt in der Wolfsschlucht-Szene im wahrsten Sinn des Wortes Kopf: Agathes Jagdschlösschen, selbst kein anheimelnder Ort, sondern eine zerstörte Stätte mit letzten Resten von Wohnlichkeit, hat sich gedreht, das Sofa hängt an der Decke, die Lampenschirme des Leuchters werden zu Töpfen. Aus ihnen nimmt Kaspar die Zutaten des zaubrischen Suds, aus dem die Freikugeln gegossen werden.
Der Teufelspakt hat einen Bocksfuß
Ouvrard fängt in szenischer Symbolik wesentliche Begriffe der Romantik ein. Die Welt ist zutiefst gespalten. Die eine Seite, die des alltäglichen Lebens, ist beschädigt, gestört, von Kräften „höh’rer Macht“ beeinflusst, denen sich die armen Menschen mit Regeln und Ritualen oder – wie Ännchen mit seinem Kettenhund Nero – mit beschwichtigendem Humor zu entziehen suchen. Die sich der „anderen Seite“ bewusst sind, wie Kaspar, versuchen, diese unfassbaren Kräfte zu nutzen, für sich zu bändigen – aber wir wissen, das gelingt nicht: Die siebente Kugel gehört immer dem Bösen, der sie nach seinem Willen lenkt. Der Teufelspakt hat einen Bocksfuß.

Streng, alt, gespenstergleich: die Brautjungfern. (Foto: Oliver Berg/Theater Münster)
Wer den Baumstamm besteigt, mag von oben eine verbindenden Sicht der romantisch zwiespältigen Welt gewinnen. Agathe versucht es, aber es gelingt ihr nicht. Nur der Eremit, der von oben seine weisen Worte strömen lässt, ist eine integrierende Figur: Er und Samiel sind eins, das „Höh’re“ spricht aus ihm, gleich ob Gut oder Böse. In seinem schmutzigweißen Mantel, den kahlen Kopf noch vernarbt vom Teufelsgeweih Samiels, verkörpert er, was den Menschen als Antagonismus, aus der Perspektive einer jenseitigen Welt aber nur als unterschiedliche Aspekte einer Existenz erscheinen mag. Gut und Böse, nicht nur als moralische, sondern auch als prinzipielle Kategorien, heben sich auf – in diesem postmodernen Ansatz ist die Münsteraner Inszenierung von Webers Oper auf der Höhe der Zeit.
Die Regie von Carlos Wagner allerdings erreicht die konzeptuelle Dichte des Buhnenbilds nicht. Sicher: Er will uns klar machen, wie Max am Unerklärlichen scheitert, wie ihn in einer Gesellschaft klarer Vorgaben und eindeutiger Zusammenhänge die Logik des Handelns und seiner Folgen abhandenkommt, wie ihn des Zufalls Hand in die Verzweiflung, sogar zur Frage nach der Existenz Gottes führt.
Wenn der Chor langsam in seinem derben Tanz erstarrt, die Bewegungen fragmentiert wiederholt, dann bei „Durch die Wälder, durch die Auen …“ Paare bildet und langsam hinaustanzt, ist das ein Aufmerksamkeit weckender szenischer Vorgang – aber er wird nicht eingelöst, es resultiert nichts daraus. Wenn zu Beginn ein ausgeweideter Hirsch an den Baumwurzeln aufgehängt wird, denken wir sicher an das „männlich‘ Vergnügen“ der Jagd – aber wenn ein Landmetzger später Schinken und Braten vom Hirsch in die johlende Menge wirft, bringt das die Zuschauer nur zum Lachen.
Lustiges Schießen auf Bierdosen
Agathe ist als Figur spannend angelegt: Sie erscheint im fahlen Mondlicht wie eine Geisterbraut, als sei sie von Heinrich Marschners „Vampyr“ gebissen, aber sie erschöpft sich dann doch in der eher larmoyanten Rolle des schreckhaften „Bräutchens“. Ännchen gibt sich in Jagdhosen und Krawatte sehr männlich, veranstaltet ein lustiges Schießen auf Bierdosen, bleibt aber am Ende als unterhaltsame Opernsoubrette ohne dezidiertes Profil.
Max geriert sich als heillos verunsicherter Jägersjüngling, der in der Wolfsschlucht den Sudel aus Luchs- und Wiedehopfaugen saufen muss und die Freikugeln zuckend in eine Schüssel erbricht – aber die Konturen seines Charakters, sein Zugriff auf das „Andere“ bleiben verschwommen. Kaspar dagegen ist ein saft- und kraftvolles Mannsbild, und Gregor Dalal macht mit seinen darstellerischen Mitteln und seinem unmittelbar wirksamen Sprechen aus ihm eine lebensvolle Persönlichkeit. Carlos Wagners Regie traut dem Stück, aber sich selbst offenbar zu wenig zu: Das Ganze schließt zu offen.
Offene Wünsche auch auf der musikalischen Seite: Stefan Veselka schlägt mit dem Sinfonieorchester Münster ein gemessenes Tempo an, was der Entwicklung der melodischen Thematik und der Ausformung des Klangs zugutekommt. Die Hörner sind lobenswert, die Klarinette hat – mit einem eher hell-fragilen Ton – schöne solistische Momente. Im Lauf des Abends arbeitet Veselka immer wieder harmonische Tiefenstrukturen aus, bringt manche Holzbläserstimme zum Leuchten. Aber der Klang des Orchesters bleibt oft pauschal, der Aufbau innerer Spannung allzu diskret. Entschiedene Akzente, packender Zugriff könnten der Musik auf die Beine helfen.
Innige Agathe, leuchtend singender Max
Münster hat mit Mirko Roschkowski einen seine Partie anstandslos bewältigenden Max: Ohne Forcieren, ohne Gewalt lässt er seinen Tenor leuchten, steigert den Verzweiflungston in der Arie, bringt für die Wolfsschlucht den panischen Unterton in der Deklamation mit. Sara Rossi Daldoss ist eine sehr innig singende Agathe, bei der man manchmal Sorge um die Stütze und den klanglichen Kern der Stimme hat. Ihre zweite Arie nimmt sie weniger vom Legato her, bildet die Töne separiert, um sie mit verschiedenen Farben zu gestalten. Auch wenn so der große Bogen sehr fragil gespannt wird: Der Ausdruck überzeugt. Eva Bauchmüller als Ännchen gewinnt nach manch leichtgewichtigem Ton an Format, singt nach der Pause mit tadelloser Diktion und einem feinen, aber substanzreichem Klang.
Plamen Hidjov ist als Kuno von Statur und Stimme ein würdiger älterer Herr; Sebastian Campione spricht als Samiel die – ansonsten bis zur Unkenntlichkeit zusammengestrichenen – Dialoge ohne „teuflische“ Plattitüde. Als Eremit ist er weniger ein balsamisch strömender als ein schneidend präsenter Bass. Der Opernchor und Extrachor des Theaters Münster – Inna Batyuk hat ihn einstudiert – glänzt in der Eröffnung, fällt aber ausgerechnet im Jägerchor auseinander, weil die Sänger über die ganze Breite verteilt auf der Drehbühne marschieren müssen. Auch das ein Bild, das keinen Bedeutungs-Zusammenhang konstituiert – ebenso wie der finale Moment, als Kaspars Leiche in Brand gesetzt wird und als flackerndes Feuer auf dunkler Bühne die Oper abschließt.
Vorstellungen: 7. und 28. April, 3. und 30. Mai, 20. und 25. Juni, 1. und 13. Juli. Karten: (0251) 59 09-100. www.theater-muenster.com