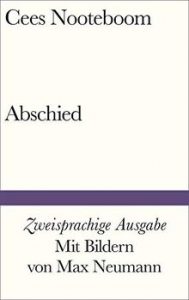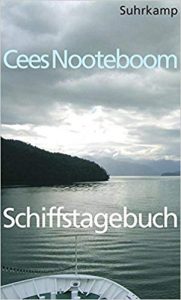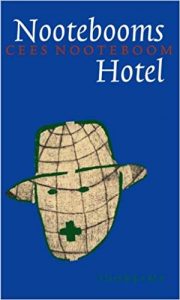In der Regel hat der Weg in der westlichen Leistungsgesellschaft ein Ziel. Man geht zur Arbeit oder zum Supermarkt, man muss Behördengänge erledigen, die alte Mutter besuchen, für den Halbmarathon trainieren, Schuhe kaufen oder wenigstens Brötchen holen. Auch die systematische Besichtigung historischer Innenstädte in artigen Gruppen oder mit Hilfe eines gedruckten Reiseführers ist durchaus üblich.
Der Flaneur (aus dem Französischen: flaner = umherstreifen, schlendern) braucht alle diese Gründe nicht, um stundenlang durch eine Stadt zu bummeln. Er hat keine Eile, er lässt sich treiben. Mal beobachtet er die Schwäne auf dem Stadtteich, mal lauscht er einem Straßenmusiker, mal trinkt er einen Espresso, sieht Passanten hinterher und lässt die Zeit vergehen. Ein Flaneur verfolgt keinerlei praktischen, wirtschaftlichen oder sportlichen Nutzen. Er sammelt Eindrücke.
Inspirationen suchen
Das ist für emsig arbeitende Menschen eher suspekt. Der kleine Müßiggang beim Cappuccino wird zwar mittlerweile akzeptiert, man darf mal Pause machen. Aber nicht zu lange, dann muss man wieder ins Büro. Oder wenigstens ins Sportstudio. Der Flaneur lächelt nur milde, grüßt flüchtig und schlendert weiter, um die nächste Ecke. Das ist seine liebste Beschäftigung. Für einen Faulenzer darf man diesen Charakter dennoch nicht halten, denn er registriert alles.

Flaneusen sind in der Kulturgeschichte nicht vorgesehen. Aber es soll sie geben… (Bild: Privat)
Viele Dichter und Journalisten verschafften sich flanierend ihre Inspirationen. Der Beschwörer des Unheimlichen zum Beispiel, Edgar Allan Poe, ließ den Ich-Erzähler seiner Novelle „Der Mann in der Menge“ (1838) nach langer Krankheit „an dem Bogenfenster des vielbesuchten Café D. in London“ Platz nehmen und das städtische Leben beobachten: „Das Gefühl der wiederkehrenden Kräfte hatte mich in jene glückliche Stimmung gebracht, die das Gegenteil von Langeweile ist, alle Sinne schärft, aufnahmefähiger macht… Alles, selbst Unbedeutendes, nötigte mir eine ruhige, forschende Teilnahme ab.“ Durch die dunstbeschlagenen Scheiben späht der Mann auf die Straße hinaus, Poe lässt ihn unermüdlich die Vorübergehenden beschreiben: die Herrschaften und Hausierer, die Bettler und Spieler, die Kuchenverkäufer und Trunkenbolde bis hin zu einem kleinen alten Mann, dessen satanisches Gesicht ihn derartig fasziniert, dass er ihm folgt – durch den Nebel der Nacht.
Kunst der Wahrnehmung
Flanieren, lernt man aus diesem Stück Literatur, hat nichts mit Dösen zu tun. Es verbessert vielmehr die Wahrnehmungsfähigkeit. „Flaneure sind Künstler, auch wenn sie nicht schreiben“, behauptet der holländische Schriftsteller Cees Nooteboom in einem Essay für die „Zeit“: „Sie sind zuständig für die Instandhaltung der Erinnerung, sie sind die Registrierer des Verschwindens, sie sehen als erste das Unheil, ihnen entgeht nicht die kleinste Kleinigkeit.“ Kein Riss im Parkhaus-Beton, keine Bausünde, keine Verwahrlosung. Und kein Vogelzwitschern im Gebüsch.
Hans Dieter Schaal, der jenseits der Szene arbeitende Architekt, Bühnenbildner, Dichter und Denker, fühlte sich von den Städten, die er besuchte, so vielfältig angeregt, dass er im Jahr 2009 seine „Stadttagebücher“ veröffentlichte. „Ich bin Erlebender und Beobachter“, schrieb Schaal im Vorwort: „Ich schaue mir die Gebäude, Straßen, Plätze, Märkte Fußgängerzonen, Malls und die Menschen an, lasse die Oberflächen auf mich wirken, spüre den Atmosphären nach. Manchmal überfällt mich die Angst, dann wieder fühle ich mich beglückt und bereichert.“ Knapp 700 eng bedruckte Seiten füllte Schaal mit Texten und selbst fotografierten Bildern.
Langsam gehen
Der Flaneur kann also auch besonders fleißig sein. Muss aber nicht. Er ist im Prinzip ein Zeitverschwender, gibt Nooteboom zu. „Wenn ich an all die Stunden – und allmählich Jahre – denke, die ich durch die Straßen der Welt geschlendert bin, dann hätte ich in dieser Zeit die gesammelten Werke von Hegel und Kant mit der Hand abschreiben können“, scherzt er. Stattdessen habe er „ein Buch gelesen, das nie zu Ende geht, ein Buch, dessen Kapitel und Buchstaben aus Gebäuden, Standbildern, Straßen, Autobussen und Menschen bestehen“.
Als „Lektüre der Stadt“ bezeichnete schon der Autor und Rowohlt-Lektor Franz Hessel (1880-1941) das Flanieren. In seinem Buch „Spazieren in Berlin“ feierte er 1929 das zweckfreie Schlendern: „Langsam durch belebte Straßen zu gehen, ist ein besonderes Vergnügen. Man wird überspült von der Eile der anderen, es ist ein Bad in der Brandung.“ Allerdings registrierte Hessel in der geschäftigen Metropole auch misstrauische Blicke: „Ich glaube, man hält mich für einen Taschendieb.“ In Paris, wo Hessel vor dem Ersten Weltkrieg einige glückliche Jahre verbrachte, war das anders: Das Flanieren als Lebensart wurde dort im späten 19. Jahrhundert erfunden und von Autoren wie Marcel Proust („Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“) gefeiert. Wie viele Bilder der Impressionisten zeigen, liebte man das zweckfreie Bummeln besonders, seit die französische Hauptstadt kein Labyrinth stinkender Gassen mehr war. Der Präfekt Georges-Eugène Baron Haussmann hatte großzügige Boulevards und lauschige Passagen angelegt – das ideale Terrain für den Flaneur, den Charles Baudelaire, Poet der „Blumen des Bösen“, als „Künstler, Mann von Welt, Mann der Menge und Kind“ beschrieb.
Melancholischer Voyeur
Nach Ansicht des deutschen Philosophen und Proust-Übersetzers Walter Benjamin (1892-1940) ist der Flaneur ein Süchtiger, ein melancholischer Voyeur, ein Detektiv und ein Verdächtiger zugleich. Benjamin widmete dem Phänomen sein unvollendetes „Passagen-Werk“, dessen Durcharbeitung allerdings nur strebsamen Geisteswissenschaftlern zu empfehlen ist. Alle anderen sollten einen leichten Mantel anziehen und einfach nach draußen gehen, in die Stadt, zum Flanieren.
Zitat:
„Hierzulande muss man müssen, sonst darf man nicht. Hier geht man nicht wo, sondern wohin. Es ist nicht leicht für unsereinen.“
(Franz Hessel, Flaneur)
Und wo bleibt die Flaneuse?
Frauen haben offensichtlich immer was zu tun. Jedenfalls kennt die Literatur keine Flaneuse. So, wie sich die Männer bei der Arbeit entschlossen bis stur auf ein Ziel konzentrieren, sind sie auch in Sachen Müßiggang durch nichts abzulenken. Immerhin gibt es bei Marcel Proust den Begriff der „Passante“ (französisch: Spaziergängerin). Dabei handelt es sich um vorbeiziehende, flüchtige Figuren, die alle Blicke und Begehrlichkeiten flanierender Herren ignorieren. In der Gegenwart bahnt sich zum Glück eine Änderung an. In dem Flaneur-Büchlein von Stefanie Proske (siehe Buchtipps) wird zwischen vielen Männern auch die Berliner Schriftstellerin Christa Moog zitiert: „Ich spazierte zum Grab von Kleist.“
Buchtipps:
„Das Passagen-Werk“
„Man darf, ohne Einschränkung, von einem epochalen Werk sprechen“, befand die Züricher Zeitung. Alle klugen Menschen nicken verständig, wenn von Walter Benjamins „Passagen-Werk“ die Rede ist. Jeder, der über das Flanieren philosophiert, wird es zitieren. Dabei handelt es sich um eine fragmentarische, aber überaus umfangreiche Sammlung von Texten, die durchzuarbeiten nicht gerade ein Vergnügen ist. 13 Jahre lang, bis zu seinem Selbstmord im Exil 1940, arbeitete der 1892 in Berlin geborene Philosoph an seinem Hauptwerk, einem Buch über seine Lieblingsstadt Paris – und wurde niemals fertig. Der Titel leitet sich ab von einer reichlich trockenen Abhandlung über die Geschichte der im 19. Jahrhundert erbauten Passagen, jene überdachten Gassen für den flanierenden Genießer. Die zweibändige Textsammlung ist nur geeignet für Menschen mit entschiedenem Bildungswillen. (Walter Benjamin: Passagen-Werk. Edition Suhrkamp, 1354 Seiten, 29,90 Euro)
„Flaneure – Begegnungen“
Das rosarote, hübsch gestaltete Büchlein der Lektorin und Politologin Stefanie Proske ist so leicht, dass es der Flaneur ohne weiteres in die Tasche stecken kann. Und die Lektüre ist ein müheloses Vergnügen für ein Stündchen im Café, denn Proske hat einige kurze Beispiele aus der Flaneur-Literatur zusammengestellt. Das geht vom alten Pariser Charles Baudelaire, der „inmitten dieses in Kittel und Kattun gekleideten Volkes“ eine „große, hoheitsvolle Frau“ entdeckte, bis zum Wiener Karl Kraus: „Dagegen zog mich von jeher das Leben der Straße an…“ Ideale Lektüre für ein müßiges Stündchen im Straßencafé. (Stefanie Proske: Flaneure – Begegnungen auf dem Trottoir. Edition Büchergilde, 198 Seiten, 14,90 Euro)
„Stadttagebücher“
Als Bühnenbildner reiste der oberschwäbische Architekt, Zeichner und Autor Hans Dieter Schaal in viele Städte von Venedig bis Kuala Lumpur. Das Flanieren wird bei ihm auch immer zum Analysieren. Was er entdeckte und bedachte, sammelte Schaal in umfangreichen „Stadttagebüchern“, die mal historische Abhandlung, mal persönliche Anekdote sind. Man kann und muss das schwere, mit eigenen Fotos illustrierte Buch nicht komplett lesen – aber man kann dem Flaneur Schaal in die eine oder andere Stadt folgen. (Hans Dieter Schaal: Stadttagebücher. Edition Axel Menges, 647 Seiten, 79 Euro).