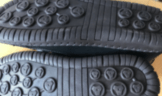Der betonierte Horror asiatischer Ballungsräume, oder: Warum das Ruhrgebiet gar nicht so übel ist

Verwechselbare Aussicht: Blick auf einen Teil Tokios (Bild: rp)
Ich bin in Asien gewesen. Kreuzfahrtschiff. Hong Kong und Shanghai, Südkorea und Taiwan, vor allem aber Japan. Mit wenigen Ausnahmen immer in Städten, in großen Städten, Megastädten – Großräume, nüchterner ausgedrückt, in die das Ruhrgebiet drei-, vier-, fünfmal hineinpassen würde. Hochstraßen auf mehreren Etagen, Hochbahnen, Hochhäuser und bei letzteren der unübersehbare Wettbewerb, wer den Größten hat, den größten Wolkenkratzer.
Das, was man sonst in Fernost so sucht, Gärten, Schreine, Historie, mickert irgendwo in der Ecke oder wird von der Stadtautobahn überdonnert. Deprimierender Gedanke des ersten Tages und vieler folgender: Hier möchtest du nicht leben.
Wahrnehmungen eines europäischen Touristen
Natürlich sind diese meine touristischen Wahrnehmungen, gelinde gesagt, ausschnitthaft und oberflächlich. Aber wie sollte ich mich annähern, wenn nicht so? Meine Passagen, um einmal ganz elegant den Titel dieses Blogs ein wenig zu drehen, waren die mit Schiff, Bussen und Taxen durch einen anderen Teil der Welt, und nun reizt das transkontinentale Vergleichen.
Darum ist es im Revier so schön
Warum also ist es im Revier so schön? Weil, einfach gesagt, die Proportionen sehr viel menschlicher sind. Weil die Hochhäuser bei uns noch sehr abzählbar sind und es hoffentlich bleiben werden. Auch in modernen Gewerbegebieten, Phoenix West in Dortmund beispielsweise, sind die Gebäudegrößen vergleichsweise moderat, der rostige alte Hochofen, den man als schwerindustrielles Memento auf dem Gelände hat stehen lassen, überragt sie. Opländers wuchtiger Verwaltungsriegel, gelegen streng genommen ja noch vor dem Gewerbegebiet, zeigt solitäre Proportion und Eleganz, und daß man dem etagenhohen Gewinde des Künstlers Jörg Wiele, das früher in der abgerissenen Hauptverwaltung hing, einen neuen etagenhohen, von der B 54 aus gut sichtbaren Glaskasten gegönnt hat, ehrt die Firmenleitung. Für Nicht-Dortmunder: Opländer ist die Firma Wilo, die ihr Geld weltweit vorwiegend mit Heizungspumpen – und Wärmepumpen – verdient.

Wohnbebauung an Tokios bedeutendsten Fluß Sumida. (Foto: rp)
Viel Grün
Thema Wohnen. Das Revier hat ja eine ausgesprochen vielfältige Siedlungsstruktur. Eigenheim mit etwas Grün ist wohl immer noch am beliebtesten, am ehesten, aber nicht nur, realisierbar an den südlichen, östlichen und vor allem nördlichen Rändern; Kreis Unna also bis weit hinein ins Münsterland, aus der Dortmunder Perspektive.
Jede Ruhrgebietsstadt, auch die (mal wieder so ein Superlativ, der knirscht, ich bitte um Entschuldigung:) verschuldetste noch, hat aber auch ein oder mehrere sehr schöne Villenviertel, ebenso, allen Zerstörungen im 2. Weltkrieg zum Trotz, ihre gründerzeitlichen Straßenzüge mit phantasievoll rhythmisierten und ausgeschmückten Fassaden. Gewiß, vielerorts gibt es das eben auch nicht mehr, und verschwunden ist es erst lange nach dem Krieg. Aber in Asien scheint man das Alte ungleich brutaler entsorgt zu haben. Auf der vor-vorletzten Documenta in Kassel hatte der chinesische Künstler Ai Wei Wei alte Stühle aufgehäuft, viele alte Stühle, Jahrhunderte alt, gerettet aus den alten Vierteln, die in China der „Stadterneuerung“ zum Opfer gefallen waren. Ein Mahnmal, ganz fraglos, für das Material aber wohl auch in Taiwan oder Südkorea zu bekommen gewesen wäre. Japan wirkt – wie gesagt, oberflächliche Wahrnehmungen eines Touristen – etwas weniger aggressiv entwickelt. Einige alte Häuser mehr, etwas mehr Grün, ein paar alte Viertel die man läßt, wie sie in den 50er Jahren schon waren.

Geschäftstraße in einem 50er-Jahre-Viertel Tokios. Auch für das Auto ist noch ein wenig Platz. (Foto: rp)
Anders wohnen
Nun hat man in Japan auch in der Vergangenheit anders gewohnt als in Europa; der größte Teil des Landes ist subtropisch, was Heizkosten spart. Andererseits sind Erdbeben ein häufiges Ärgernis, dem man baulich erst seit wenigen Jahrzehnten Paroli bietet, mit intelligenter Technik, und, so jedenfalls der Eindruck von etlichen Rohbauten, mit vielen Diagonalstrukturen in der Konstruktion. Was in früheren Zeiten aus Stein errichtet wurde, überlebte oft nicht lange, weshalb Holz ein traditioneller Baustoff ist. In schlicht gebauten Häusern also wohnen viele Menschen, und weil ein eigener Stellplatz in vielen Städten Vorschrift ist, muß oft auch das Auto noch in die Behausung passen. Man sieht viel gehobene Mittelklasse in engen Straßen vor nicht sehr stabil wirkenden Behausungen stehen, ein etwas absurdes Bild für europäische Augen.
Einfache Wohnungen
Vielleicht hat der geneigte Leser, die geneigte Leserin ja Wim Wenders’ schönen Film „Perfect Days“ über einen Tokioter WC-Putzmann gesehen, der in guter Eigenschwingung lebt und ein ebensolches japanisches Haus (Hütte?) bewohnt. Es scheint mir ebenso authentisch zu sein wie es der Getränkeautomat davor ist; in Japan stehen sie, oft auch zu mehreren, buchstäblich an jeder Ecke.
Wo wir schon beim Thema sind: Machen wir bei den japanischen Klos weiter, nicht den High-Tech-Tempeln aus dem Wenders-Film, sondern den „einfachen“ öffentlichen und den gastronomischen. Da haben sie wirklich die Nase vorn, die Japaner. Warmwasserstrahlreinigung, die sich zudem individuell ausrichten läßt, scheint überall selbstverständlich zu sein, und selbstverständlich auch ist der Sitz elektrisch beheizt. Man kann sich daran gewöhnen, wenn erst einmal der Zwangsgedanke blasser wird, daß hier kurz vorher jemand anderes gesessen hat.
 Messer und Gabel für alle
Messer und Gabel für alle
In einem landestypischen Imbiß übrigens, kleine Episode am Rande, wo man dankenswerterweise am Tresen sitzen konnte, hatten sie ebenfalls so ein Superklo. Aber leider nur eine Gabel, ansonsten Stäbchen. Fünf Minuten später gab es dann aber Gabeln für alle, von uns erbeten und vom gastronomischen Nachbarn flott organisiert. Als überaus nützlich erwiesen sich nicht nur in dieser Situation die Übersetzungsprogramme für mobile Telefone, Schrift und Sprache, die immer besser werden und die alle auf ihren Telefonen hatten, wir deutsche Touristen ebenso wie unsere japanischen Wirtsleute. Mit ihrer Hilfe konnten wir auch glaubhaft darlegen, daß uns am freundlicherweise eingedeckten Tisch nicht gelegen war; in die Hocke kommen wir Ü70er nur mit Mühen, und wieder hoch gleich gar nicht. Das haben sie natürlich verstanden.
Liebenswerte Menschen
Überhaupt, die Freundlichkeit. Asiaten, Japanern zumal, sagt man ja eine Freundlichkeit nach, die an Unterwürfigkeit grenzen soll. Meine zweite, etwas gegenläufige Erwartung war, daß das Land von lauter sehnigen, humorlosen Kampfsportmönchen bevölkert ist, wie man sie aus dem Kino kennt. Tatsächlich aber traf ich immer wieder freundliche, höfliche, interessierte Menschen, und ein, zwei Gespräche auf der Straße kamen nur deshalb nicht zustande, weil ich des Japanischen in Schrift und Sprache ebenso unmächtig war wie mein jeweiliges Gegenüber des Englischen. Das war Mal um Mal sehr schade, und vielleicht sollte man im nächsten Leben Japanisch wählen statt Französisch. Steht aktuell nicht zur Entscheidung an.
Taxifahren in Tokio
Sehr empfehlenswert übrigens ist das Taxifahren in Japan. Höfliche und korrekte, meistens etwas ältere Herren mit weißen Handschuhen, Krawatte und Dienstmütze führen die Fahrzeuge, und unter übermäßigem Respekt für innerstädtische Geschwindigkeitsbeschränkungen leiden sie erkennbar nicht. Vier Personen können mitfahren, weshalb Taxi dann nicht sehr viel teurer als U-Bahn ist. Und man sieht natürlich mehr. Übrigens gelten Trinkgelder in Japan als unüblich (werden aber durchaus angenommen). Als Taxen fahren noch immer viele Toyotas aus den Achtzigern, mit viel Platz und einem Bildschirm in der Kopfstütze des Fahrers, über den, für hinten Sitzende, pausenlos Werbung läuft. Den (übrigens recht flüssigen) Verkehr sollte der kontinentaleuropäische Fahrgast nicht sonderlich beachten, auch wenn der schwere Unfall auf der nächsten Kreuzung unausweichlich scheint. In Japan wird links gefahren, deshalb sieht das manchmal so gefährlich aus.
Das kleine Trittbänkchen
Zum Thema Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft noch eine kleine touristische Beobachtung. In Japan (nach meiner Beobachtung auf dieser Reise: nur in Japan) stellen die Fahrer der Reisebusse ein kleines Trittbänkchen auf den Asphalt, das den Touristen das Besteigen des Busses problemlos ermöglicht. So soll es sein!
So schnell wie eine Pistolenkugel
Richtig, es ging ja um den Vergleich von Ballungsräumen. In Japan werden sie mit Höchstgeschwindigkeit von den „Bullet trains“ durchfahren, quasi „durchschossen“. Denn Bullet Train wäre wörtlich zu übersetzen mit Pistolenkugel-Zug, und so etwas ist auch gemeint: gleich einem abgeschossenen Projektil schießen die Züge aus dem Umland in die Zentren und zurück, was den Pendlern viel Zeit spart. In kleinerem Stil könnte man so etwas doch auch bei uns machen, zwischen Düsseldorf und dem Duisburger Problemstadtteil Marxloh vielleicht? Drei-, viermal so schnell wie der RRX? Ist nur so ein Gedanke, aber die grassierende Wohnungsnot bei uns wird man nur durch den Bau neuer Stadtviertel abmildern können, die dann, ebenso wie manche „abgehängte“ Stadteile, mit schnellen Schienenverbindungen an die Metropolen angeschlossen werden könnten, müßten.
Die Bahn
Eisenbahn in Japan ist übrigens ganz überwiegend die äußerst gut beleumundete Personeneisenbahn. Zehnmal so viele Japaner wie Deutsche nehmen den Zug – dafür werden in Deutschland knapp zehnmal so viele Güter auf der Schiene bewegt wie in Japan, entnehme ich einer Statistik der japanischen Botschaft. Einiges geht auf dem Seeweg – Japan ist Inselland -, das meiste aber geht über die Straße. Deshalb haben die Japaner, ist zu lesen, jetzt das gleiche Problem wie wir, die LKW-Fahrer werden knapp. Und das ist jetzt kein so tolles Schlußwort, aber auch dieser Aufsatz muß sein Ende finden.