Langjähriger Dortmunder Journalistik-Professor Ulrich Pätzold legt Berlin-Buch vor
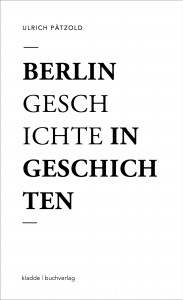 30 Jahre war Ulrich Pätzold ordentlicher Professor für Journalistik in Dortmund. Als er 1978 in die Westfalenmetropole berufen wurde, um den seinerzeit neuen Studiengang mit aufzubauen, kam er aus Berlin, damals noch eine geteilte Stadt. Nach seiner Emeritierung kehrte er zurück an die Spree und legt jetzt ein Buch vor, mit dem er den Leser einlädt, ihn auf seinen Spaziergängen durch die Hauptstadt zu begleiten.
30 Jahre war Ulrich Pätzold ordentlicher Professor für Journalistik in Dortmund. Als er 1978 in die Westfalenmetropole berufen wurde, um den seinerzeit neuen Studiengang mit aufzubauen, kam er aus Berlin, damals noch eine geteilte Stadt. Nach seiner Emeritierung kehrte er zurück an die Spree und legt jetzt ein Buch vor, mit dem er den Leser einlädt, ihn auf seinen Spaziergängen durch die Hauptstadt zu begleiten.
Gern abseits der Touristenpfade macht er sich auf den Weg durch die Stadtbezirke und erzählt Episoden und Geschichten aus der wechselvollen Vergangenheit „seiner“ Stadt. 15 Jahre hat er hier gelebt, zunächst studiert (Publizistik, Philosophie, Theaterwissenschaften, Musik- und Literaturwissenschaften), noch während des Studiums mit journalistischer Tätigkeit für RIAS Berlin und viele andere Medien begonnen.
Der Autor kennt nicht nur die Namen von unzähligen Straßen, Plätzen, Gebäuden und Parks, er weiß auch, was sich dort vor Zeiten abgespielt hat und verknüpft das Früher mit dem Heute. So betrachtet er den BER, also den Berliner Flughafen, weniger als ein Objekt, das inzwischen schon zum Gespött verkommen ist, als vielmehr als ein Projekt, das vor allem die Bürger aus dem Stadtteil Friedrichshagen auf den Plan gerufen hat. Dass sie genau in einer der Einflugschneisen wohnen, ist ein sehr konkreter Erklärungsansatz für die andauernde Gegenwehr, eine andere Begründung hat eher historische Wurzeln und atmosphärische Elemente. Hier war nämlich Ende des 19. Jahrhunderts die neue Kunstrichtung der Naturalisten zuhause.
Nicht minder geschichtsträchtig kommt Friedenau daher, es hat sogar den Anschein, als habe man es mit einem Kristallisationspunkt der Vergangenheit Berlins zu tun. NS-Reichspropagandaminister Goebbels wohnte hier und schrieb seine berüchtigte Rede, in der er zum „Totalen Krieg“ aufrief, ebenso der Gründer der Comedian Harmonists, die sich wegen der Verfolgung durch die Nazis auflösten. Mit August Bebel, Karl Kautsky und Karl Liebknecht hatten die führenden Vertreter der Sozialdemokratie hier ebenso ihre Wohnungen wie Rosa Luxemburg. Ulrich Pätzold erzählt von deren (Zusammen-)Leben, ihren Idealen und auch ihren internen Konflikten.
Die Großstadt lebt mit und von ihren Widersprüchen, lässt sich aus Ulrich Pätzolds Beschreibungen herauslesen. Zu den vielen Beispielen gehört der Kiez. Er ist Rückzugsgebiet ins Private, ohne ihn wäre eine Stadt von Welt wie Berlin aber nicht Berlin. Dabei ist jeder Kiez anders, das einigende Band besteht wohl darin, dass man hier das eigene Tempo drosselt.
Der Schnelllebigkeit der Zeit, durch die manches dunkle Kapitel in Vergessenheit zu geraten droht, setzt der Autor die Erinnerung an Opfer und Täter entgegen. Dass es vor allem die Jahre des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges sind, auf die der Journalist immer wieder zu sprechen kommt, verwundert deshalb nicht, weil die Nazis überall in der Stadt blutige Spuren hinterlassen haben. Allein aus Berlin wurden 55.000 Juden verschleppt und ermordet.
Selbst in Kapiteln, in denen man den schrecklichen Schatten der Nazis kaum vermuten würde, sind sie allgegenwärtig. So erzählt Pätzold die bizarre Geschichte der Brüder Sass, Einbrecherkönige in der Weimarer Zeit mit viel Sympathie in der Bevölkerung, die die Polizei zum Narren hielten und im Konzentrationslager Sachsenhausen von Rudolf Höss, dem späteren KZ-Kommandanten von Ausschwitz, erschossen wurden. Widerstand gegen das NS-Regime hat es übrigens, wie der Autor beschreibt, vielfach auch bei den „einfachen Leuten“ gegeben, wie er es am Beispiel eines Bürstenfabrikanten und einer Prostituierten beschreibt.
Wenn im Berlin von heute viele Ethnien nebeneinander leben, sieht der Autor darin eine große Chance für diese Stadt, die mit der Kongresshalle für die Kulturen der Welt ohnehin schon einen sichtbaren Ausdruck der Völkerverständigung geschaffen habe. Mit aller Vehemenz wehrt er sich gegen die Thesen eines Thilo Sarrazin, wobei sehr deutlich wird, dass Pätzold nicht nur um den einstigen Berliner Finanzsenator geht, sondern um alle, die – auf welche Weise auch immer – Fremdenhass schüren. Den unterschiedlichen Nationalitäten ist ein Tag zu verdanken, der für Berlin verblüfft. Einmal im Jahr feiert man nämlich auch hier Karneval, einen Karneval der Kulturen.
Von Feierlaune sind die Menschen weit entfernt, die an der Lehrter Straße, dem Sitz der Stadtmission, Zuflucht suchen. Obdachlose kommen hierher, 4000 von ihnen leben irgendwo in dieser Stadt und gehören auch zu ihrem Bild dazu.
Um die Vielfalt von Berlin darzustellen, können und dürfen die Kultur und die Architektur ebenso wenig fehlen wie die Erinnerung an die Mauer. Dass die Museen mehr als nur die Nofretete zu bieten haben und Berlin auch trotz des verheerenden Krieges reich ist an imposanten Gebäuden, zeigt Pätzold an zahlreichen Beispielen auf. Welche irrwitzige Folgen die Teilung Berlins haben konnte, führt der Autor anhand des „Hamburger Bahnhofs“ vor, der nur wenige Jahre ein Bahnhof gewesen ist.
Ulrich Pätzold: „Berlin – Geschichte in Geschichten.“ kladde Buchverlag. 383 Seiten, 19 Euro