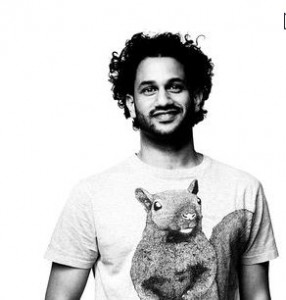Kennen Sie RebellComedy? Nein? Dann sind Sie vermutlich über 40 und haben nur deutsche Vorfahren. RebellComedy gelingt, woran sich Kulturveranstalter in ganz Deutschland seit Jahren die Zähne ausbeißen: Sie erreichen die Kinder und Enkel der Migranten. Ihr Markenzeichen: coole Harmlosigkeit. Eine erstaunliche Erfolgsgeschichte:
»Ich liiiebe Deutschland«, sagt der junge Mann und legt dabei die Hand aufs Herz. »Ich bin keiner von diesen Typen, die sagen: Scheiße Deutschland. Wallah, Deutschland voll der Hurensohn. Neeeein! In keinem anderen Land könnte jemand wie ich 15 Minuten vor so einer Menge von Leuten stehen und einfach Blödsinn von sich geben.«
Der Mann heißt Pu: 27 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Münster, geprägt gleichermaßen durch seine iranischen Eltern und die aus den USA auch nach Westfalen importierte HipHop-Kultur. Seit seiner Jugend rappt er und kombiniert seinen schnellen Sprachwitz auf der Bühne gewinnbringend mit der Unfähigkeit, auch nur eine halbe Minute still zu stehen.
Pu ist, könnte man sagen, ein typischer Deutscher seiner Generation. Nur würde das in Deutschland kaum jemand so sagen. Wer Pu auch nur den Bruchteil einer Sekunde anschaut, hat in der Regel zuallererst dieses eine Wort im Kopf: Ausländer. Pu kennt das, natürlich. Er verdient sein Geld damit.

Foto: Mirza Odabasi
»Wenn ich im Iran so eine Menge Scheiße von mir gäbe, könnte ich nichts erreichen. Obwohl, doch. Wenn ich wirklich, wirklich viel Scheiße von mir gebe … könnte ich Präsident im Iran werden«, geht seine Nummer weiter.
Pu ist einer von zehn Mitgliedern der RebellComedy. Wie die anderen bastelt er an seiner Solo-Karriere, absolviert Auftritte bei »TV Total«, doch die Marke »RebellComedy« ist größer als er. Wenn sie gemeinsam auf Tour gehen – ab Mai ist es wieder soweit –, sind die Hallen meist ausverkauft. Sie haben einen Moderator dabei, der zwischen den Auftritten der Comedians überleitet, und einen DJ. Sie posten und twittern, machen Selfies mit dem Publikum und mischen sich nachher unters Volk. Ein bisschen erinnert ihre Show an Breakdance: eine große Crew, von der immer mal jemand anders im Mittelpunkt steht, während die übrigen vom Rand Respekt zollen.
Und dann steht sie da mit den Eintrittskarten in der Hand, vor dem Bahnhof Langendreer, vor der Bonner »Springmaus«, vor dem Kölner Gloria-Theater oder dem Bielefelder Theaterlabor: diese schwer erreichbare Zielgruppe junger Menschen mit Migrationshintergrund, an der sich Kulturveranstalter seit Jahren die Zähne ausbeißen. Kein noch so gut gemeintes Stück über Diskriminierung konnte sie in die Theater locken. Selbst die erste Generation der Ethno-Comedians erreichte sie kaum: Im Publikum von Kaya Yanar, Bülent Ceylan oder Fatih Cevikkollu sitzen überwiegend gebürtige Deutsche. Junge Frauen mit Kopftuch, die hat nur RebellComedy. Warum?
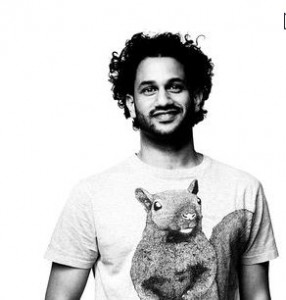
Usama Elyas, Mit-Gründer von RebellComedy. Foto: Mirza Odabasi
Das Verrückteste an ihrer Erfolgsgeschichte ist vielleicht die Chuzpe, mit der sie sich aufmachten, die Kleinkunstbühnen der Republik zu erobern. RebellComedy startete künstlerisch unerfahren bis unprofessionell, dafür mit theoretischem Unterbau, gutem Marketing und dem aus dem HipHop geborgten Selbstbewusstsein eines Underdogs, der ganz nach oben will: Denen zeigen wir es.
Die Geschichte beginnt im beschaulichen Eschweiler und im benachbarten Aachen. Hier wachsen die Gründer der Gruppe auf: Babak Ghassim, heute RebellComedy-Regisseur, und Usama Elyas. Als Usama 13 Jahre alt war, wurde sein Vater zum wohl prominentesten Gesicht des Islam in Deutschland: Dr. Nadeem Elyas war 12 Jahre lang Vorsitzender des Zentralrates der Muslime. Ein konservativer Mann, der seine Kinder religiös erzog. Usama und Babak spielten in ihrer Jugend erfolgreich Basketball, wuchsen in die HipHop-Szene hinein. Der Freundeskreis war groß, die beiden begnadete Alleinunterhalter.
»Er war lustig«, erinnert sich auch Dieter Rehder, Usama Elyas‘ Professor für Grafikdesign an der Fachhochschule Aachen. Mehr noch erinnert sich Rehder aber daran, dass sein Student das Seminar freitags stets um 12 Uhr verließ, um zum Freitagsgebet zu gehen. Auch an Elyas’ Diplomthema erinnert sich Rehder gut: Es ging um eine Fernsehshow für StandUp-Comedy namens »Fladenbrot«. Die Comedians: allesamt junge Leute mit Migrationshintergrund, die aus ihrem Leben erzählen – davon, wie das Leben eben so ist, wenn die Eltern oder Großeltern aus dem Iran, der Türkei, Marokko stammen.
»Eher weniger« habe er an den Erfolg eines solchen Formats geglaubt, gibt Rehder zu. Usama Elyas weiß das. »Der Prof fand es schrecklich; er meinte, das sei ein Nischenprodukt. So, als würden Behinderte Witze über ihre Behinderung machen.« Doch der heute 33-Jährige ließ sich nicht beirren: »Das ist keine Nische, das ist eine ganze Generation, die hier aufwächst. Die werden morgen nicht auswandern. Ich bleibe hier! Und von mir gibt es Millionen.«
Man kann es nicht anders sagen: Er hatte recht. Und er hatte seinen besten Freund Babak, der inzwischen deutsche Sprache und Literatur studierte und Hausarbeiten über »Sprache und Humor bei StandUp-Comedy« schrieb. Heute promoviert Babak Ghassim, schreibt Film-Drehbücher und Texte für Poetry Slams.

„Pu“ von Rebell Comedy. Foto: Mirza Odabasi
Die Idee, zusammen eine Comedyshow zu machen, war schon länger in der Welt. »Niemand, den wir kannten, schaute deutsche Comedy. Das war uns zu platt.« Im Freundeskreis dagegen ergab eine Pointe die andere, Abende wurden durchgelacht – »ganz ohne Alkohol«, so Elyas, wieder breit grinsend.
Dass Deutsche Alkohol brauchen, um locker zu werden – ein Klischee-Klassiker. Doch Klischees auf die Bühne bringen, das wollten sie gerade nicht. Das machten schon die anderen.
»Comedy für Deutsche, die endlich über Ausländer lachen dürfen, weil der Ausländer den Witz selbst macht – das ist eine andere Perspektive. Ich schäme mich fremd, wenn ich das sehe.«
Tatsächlich verstecken sich hinter dem Humor der Ethno-Comedy-Pioniere häufig Bewältigungsstrategien. Im Magazin „Der Spiegel“ verglich der Autor die Herkunft der Komiker mit dem Hängelid eines Karl Dall: Die Rolle als Witzbold helfe, mit Ausgrenzung und Ablehnung klarzukommen.
»Diejenigen Situationen veranlassen den Menschen zum Lachen oder Weinen, auf die er keine adäquate Antwort weiß, zu denen er sich nicht mehr sinnvoll verhalten kann«, schreibt der niederländische Soziologe Anton C. Zijderveld in seiner »Soziologie des Humors«. Lachen entspannt und bringt Entlastung.
Kollektive Therapie? Das weisen die Comedy-Rebellen von sich. Sie wollen nicht, dass ihre Herkunft im Vordergrund steht. Sondern? »Themen! Erzählt auf eine natürliche Art und Weise. Authentisch«, beschreibt es Usama Elyas.
Die Comedians schlüpfen nicht in Rollen, wie es etwa die Berlinerin Idil Baydar als türkische Proll-Tussi »Jilet Ayshe« tut. Sie erzählen on stage genauso, wie sie es backstage tun, und sie erzählen gut, sehr gut. Wirklich komisch sind ihre Texte eigentlich nur in Kombination mit der Performance.
Usama Elyas’ Themen auf der Bühne drehen sich häufig um die Familie. Er redet darüber, wie viel Überwindung es ihn gekostet habe, einem anderen Mann gegen dessen Willen etwas in den Hintern zu schieben – nämlich seinem Sohn ein Zäpfchen. Der Ethno-Dreh versteckt sich im Subtext, und in dem geht es um Homophobie. Elyas weiß genau, dass er bei einem überwiegend muslimischen Publikum jeden Nerv trifft. Schwule lösen bei vielen Muslimen ähnliche Reflexe aus, wie Ausländer bei vielen Deutschen: Ab- und Ausgrenzung. Man ist tolerant, aber … Homophobie und der Umgang damit sind Dauer-Themen der RebellComedians.
Humor ist eigentlich selten rebellisch. Er spiegelt und festigt die Normen und Werte einer Gruppe, die sich lachend ihrer selbst vergewissert. Wer mitlacht, gehört dazu. Das stärkt die Gemeinschaft. Viele Zielgruppen haben ihre humoristischen Helden: Männer und Frauen, Landbewohner und Großstädter, Lehrer und Schüler, Gläubige, Linke, Grüne. Die Nische für die Kinder der Migranten war noch frei – eine allerdings inhomogene Zielgruppe, von extrem konservativ bis äußerst liberal. Mit Hass-Kommentaren im Internet oder Anfeindungen hatten RebellComedy trotzdem kaum je zu tun. Das liegt auch an ihrer Harmlosigkeit. Usama Elyas redet vom Taktgefühl, das ein Comedian haben müsse, von Sympathie, die er wecken soll. Dass er »niemandem weh tun« will. Darf Satire alles? »Nein«, sagt Babak Ghassim, ohne zu zögern.
Im Publikum kommt diese Haltung an. Zum Beispiel bei Yasmin Ejjyied, 25, Gelsenkirchenerin mit marokkanischen Wurzeln. »RebellComedy machen Witze über sich selbst, nicht über andere Menschengruppen«, sagt sie. »Kaya Yanar fand ich zu aggressiv. Er hat eine Frau aus dem Publikum bloßgestellt.« Zu RebellComedy sei sie eigentlich wegen Enissa Amani gegangen, habe dann Tränen gelacht und sich gleich Tickets für die nächste Tour gesichert.

Enissa Amani, einzige weibliche Comedian bei RebellComedy. Foto: Mirza Odabasi
Enissa Amani, derzeit einziges weibliches Mitglied der RebellComedy, ist so ziemlich das Gegenteil der Berlinerin Idil Baydar, die die türkische »Cindy aus Marzahn« verkörpert. Amani ist schön wie ein Model. Perfekt frisiert und manikürt, in kurzem Rock und hohen Stiefeln erzählt sie mit ihrer Kleinmädchenstimme, wie sie ihrem Freund die Koffer packt, wenn er zu lange braucht für den Weg von der Arbeit nach Hause – und dass auch ihr Freund mega-eifersüchtig sei, sogar auf den Paketboten (»der Bastard«). Enissa Amani, inzwischen Kölnerin mit iranischen Wurzeln, ist das Role Model vieler junger Frauen. »Sie sieht aus wie ne Tussi. Aber Tussis werden unterschätzt!«, formuliert es Amani-Fan Yasmin Ejjyied.
Amani, Elyas, Ghassim und die anderen, sie sind die Stimme einer Generation, die in Schule und Ausbildung zwar das Gleiche gehört und gelernt hat wie die deutschen Freunde, aber häufig ganz anders erzogen wurde. Wenn Comedian Benaissa erzählt, wie er zum ersten Mal bei seiner ersten deutschen Freundin zu Hause ist, von deren Vater kumpelhaft begrüßt wird und dennoch Angst hat, jede Minute verhaftet zu werden – dann johlt das Publikum ein Johlen des Erkennens.
Schön und gut, könnte man einwenden – aber was ist nun das Rebellische an RebellComedy? Die Antwort von Babak Ghassim ist wirklich witzig – und bezeichnend. Er erfindet kurzerhand eine neue Übersetzung für »Rebell«. Das leitet sich zwar vom lateinischen »bellum«, Krieg, ab, aber »belle steckt ja auch darin, französisch für »schön«. »Wir renovieren Comedy, machen sie wieder schön«, sagt er. Es ist lustig und lehrreich, dabei zuzusehen.
(Der Beitrag erschien zuerst in der April-Ausgabe des NRW-Kulturmagazins K.West)