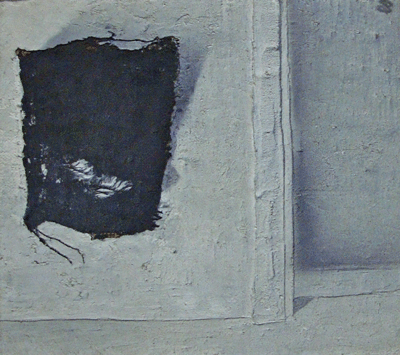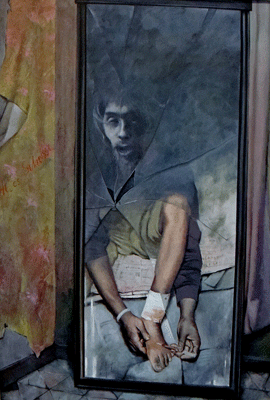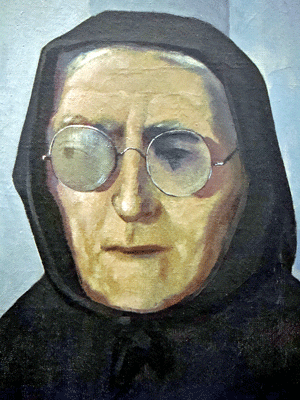Eine Begegnung mit dem großen Journalisten Georg Stefan Troller (96) – und ein verdienstvoller Verleger aus Köln
Unser Gastautor Heinrich Peuckmann über eine Begegnung mit dem vorbildlichen Journalisten Georg Stefan Troller, der inzwischen 96 Jahre alt ist. Anlass war die Verleihung des Hermann-Kesten-Preises in Darmstadt:
Diesjähriger Träger des Hermann-Kesten-Preises, gestiftet von der Autorenvereinigung PEN und vom Land Hessen, ist der Kölner Verleger Thomas B. Schumann, der in seinem Verlag Edition Memoria ausschließlich Bücher verfolgter Schriftsteller herausbringt, die vor den Nazis fliehen mussten und die nach dem Ende der Nazizeit oftmals nicht mehr die Anerkennung fanden, die sie vorher gehabt hatten.

Von links: der legendäre Journalist Georg Stefan Troller, der Verleger und Kesten-Preisträger Thomas B. Schumann und unser Gastautor, der Schriftsteller Heinrich Peuckmann. (Foto: Tanja Kinkel)
Es ist eine höchst verdienstvolle Arbeit, die Schumann da für die deutsche Literaturgeschichte leistet und die ihn oft genug an finanzielle Grenzen gebracht hat. Die Laudatio bei der Preisverleihung in Darmstadt war etwas ganz Besonderes, denn sie hielt zur Freude der Veranstalter der Fernsehjournalist Georg Stefan Troller, der, inzwischen 96 Jahre alt, extra aus Paris angereist war.
Troller ist unter den Journalisten eine Institution, sein „Pariser Journal“ im Fernsehen ist unvergessen. Der Bezug zwischen Preisträger und Laudator ist schnell geklärt. Troller veröffentlicht noch jedes Jahr ein neues Buch, gerne in Schumanns Edition. Entsprechend persönlich fiel Trollers Rede aus, in die er das Schicksal einiger der verfolgten Schriftsteller einflocht. Eingeleitet hat er sie aber mit einem schönen Zitat. Nach viel Lob bei seiner Vorstellung zitierte er seinen Vater, einen jüdischen Pelzhändler, der mal zu ihm gesagt hat: „Also Georgie, dass aus dir noch was geworden ist, ich hätte es nicht gedacht.“
Für die US-Army gegen die Nazideutschland gekämpft
Troller ist als österreichischer Jude selbst ein Opfer der Nazis, musste über die Tschechoslowakei und Frankreich in die USA fliehen, wurde dort eingezogen und kämpfte in der US-Army gegen Nazideutschland. Nach dem Krieg blieb er in Europa, fand aber, wie viele Exilierte, keinen Anschluss mehr in seiner alten Heimat und blieb daher in Frankreich. Auch dies ist ein Faktum, dass es zur Kenntnis zu nehmen gilt, genau wie die Tatsache, dass hauptsächlich im Westen die Exilautoren wenig bis gar nicht beachtet wurden, in der DDR dagegen schon.
In der Reihe seines Pariser Journals, in dem er mit sonorer Stimme seine Kommentare vortrug, hat er großartige Sendungen produziert und dabei oft verfolgte Autoren vorgestellt. Dazu gehörte Georg K. Glaser, dessen großartiger Roman „Geheimnis und Gewalt“ etwa alle zwanzig Jahre wiederentdeckt wird. Seine kommunistische Jugend schildert Glaser darin in einer großartig-kraftvollen Sprache, die an Luther erinnert. Von den Nazis wurde er in Abwesenheit zum Tode verurteilt, floh nach Frankreich, kam als französischer Soldat in deutsche Gefangenschaft, aber die Nazis fanden nicht heraus, wer dieser vermeintliche Franzose in Wirklichkeit war. Später blieb auch er in Frankreich und betrieb bis zu seinem Tod 1995 eine Silberschmiede in der Nähe der „Place de la Concorde“.
An Glasers Roman ist die Schilderung seiner Abkehr vom Stalin-Kommunismus besonders interessant, die er beeindruckend schildert. Auch entlarvt er anhand von eindrucksvollen Erlebnissen diese Ideologie. Eines der wenigen Bilddokumente über diesen völlig unterschätzten Autor hat Troller produziert.
Gespräche mit Ezra Pound und William Somerset Maugham
Troller war es auch, dem der große Ezra Pound ein Interview gab, das einzige nach Pounds vielen Jahren in der Psychiatrie. Groß war Pound in zweifacher Hinsicht, in seiner Lyrik nämlich, den Pisaner Elegien – und in seinem schrecklichen Irrtum bei seinen Hetzreden im italienischen Rundfunk für Mussolini. Wie ein solcher Autor beides zusammen bringen konnte, diese großartigen Gedichte, dazu seine absolute Hilfsbereitschaft für andere Autoren und dann die rassistischen Nazireden, wird vielleicht nie ganz zu klären sein. Troller hat er gesagt, dass er nach seinem Irrtum schweige, das sei es, was ihm übrig geblieben sei. Aber er hätte das Schweigen nicht gesucht, es sei zu ihm gekommen. Nach der Preisverleihung hatte ich Gelegenheit, mit Troller darüber zu sprechen. Eine tiefere Erklärung für Pounds Handeln hat auch Troller bis jetzt nicht.
Die ehemaligen Autorenfreunde, die Pound vor der Nazizeit hatte, haben ihn übrigens alle fallen gelassen, Ausnahmen waren William C. Williams, obwohl Pound ihn in seinen Hetzreden auch noch verleumdet hatte – und Ernest Hemingway. Was dann doch für die Menschlichkeit dieser beiden Autoren spricht.
Somerset Maugham hat Troller ebenfalls ein Interview gegeben und dabei tiefe Einblicke in sein Seelenleben gegeben. Das war halt die Stärke von Troller, dass er den Nerv seiner Interviewpartner traf und sie ihm vertrauten. Maugham, der über 80 Bücher schrieb, die fast alle Bestseller wurden, vertraute Troller an, dass er selten in seinem Leben glücklich gewesen sei. An ihm nagten bis ins hohe Alter (auch er wurde über 90) die Demütigungen aus der Jugendzeit, denn Maugham war Stotterer. Der Spott, den er als Kind deswegen ertragen musste, hat ihn lebenslang verletzt.
Wenn das Gegenüber tiefes Vertrauen fasst
Das war es, was Trollers Reportagen so einzigartig macht, der tiefe Einblick in die porträtierten Menschen. Es war seine große Kunst, sein Gegenüber so gut zu verstehen, dass der Vertrauen zu ihm fasste.
Troller ist den damaligen Verantwortlichen in den Sendern dankbar, dass sie ihm die Chance gaben, bei ihnen mitzuarbeiten. Wenigstens hier hat der Exilautor wieder Tritt fassen können. Er hat es den verantwortlichen Redakteuren mit unvergesslichen Reportagen gedankt. Troller hat sich immer dem deutschen Sprachraum zugehörig gefühlt, nur hier wieder heimisch zu werden, das hat er nicht geschafft.
So bleibt ein geteilter Blick auf Troller. Einmal die Freude über seine journalistische Arbeit und der Respekt davor, dann die Wehmut, dass solche Sendungen heute fehlen. Einen zweiten Georg Stefan Troller müsste es geben, habe ich gedacht, als ich ihm in Darmstadt begegnete. Der Original allerdings, das konnten alle Zuhörer bei der Darmstädter Preisverleihung erleben, ist trotz des hohen Alters noch erstaunlich fit. Weitere Bücher in Schumanns Edition Memoria sind bestimmt noch zu erwarten.