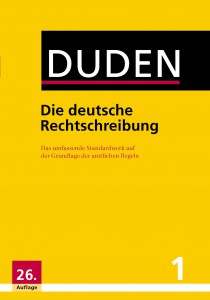Bonn. Absichtslos ins Blaue gezielt und trotzdem ein aktueller Treffer! Vor eineinhalb Jahren hatte das Bonner Haus der Geschichte begonnen, seine Ausstellung „Man spricht Deutsch” vorzubereiten. Da konnte noch niemand wissen, dass Ende 2008 eine fast hitzige Debatte darüber aufkommen würde, ob unsere vorwiegende Landessprache als Leitideal im Grundgesetz verankert werden soll.
Mal abgesehen von solchen Bestrebungen, hört sich auch folgender Befund zweischneidig an: Als „Geltungszwerg und Bedeutungsriese” könne das Deutsche (je nach Perspektive) gelten. Prof. Hans Ottomeyer fand die paradox klingende Formulierung, die ungefähr dies besagt: Weltweit spielt unsere Sprache nur eine Nebenrolle, doch hat sie sich so reich entfaltet wie kaum eine andere. Wenn das kein Grund genug zur Freude am geschliffenen Wort ist!
Der Geltungszwerg
gilt zugleich als
Bedeutungsriese
Ottomeyer leitet das Deutsche Historische Museum in Berlin, das diesmal eng mit dem Bonner Haus der Geschichte kooperiert und auch den selben Ausstellungs-Architekten engagiert hat. Vernünftige Arbeitsteilung: Bonn konzentriert sich jetzt auf den Sprachwandel seit dem Zweiten Weltkrieg, Berlin wird ab Januar bis in die Anfangsgründe der Sprachgeschichte zurückblicken.
Der Parcours ist ebenso eng wie kurzweilig geraten: Dicht an dicht sind rund 500 Exponate angehäuft, die so gut wie jeden Aspekt der deutschen Gegenwartssprache anklingen lassen. Einschlägige Tondokumente, Filmausschnitte (natürlich auch Gerhard Polts Satire „Man spricht deutsh”) und anspielungsreiche Gegenstände lockern die Abfolge der Schriftstücke auf.
Da geht es um frühkindlichen Spracherwerb, um ein- und ausgewanderte Ausdrücke, um die hässlichsten und schönsten (Libelle, Habseligkeiten) Wörter, den gar mächtigen Einfluss des Englischen, um Sprachprobleme der Migranten, deutsch-deutsche Vokabel-Differenzen und um die allzeit wechselhaften Jugend-Jargons seit dem flockigen Gerede der „Halbstarken” in den 50er Jahren („Zentralschaffe”) – bis hin zum türkisch-deutsch gemixten Straßen-Idiom „Kanak-Sprak”.
Auch Seitenblicke auf Gebärdensprache, Dichtkunst und Dialekte fehlen nicht. Werbe- und Polit-Sprache (längst nicht mehr so knackig wie bei Wehner und Strauß) geraten gleichfalls ins Visier. Vielerlei Stoff, fürwahr.
Etliche weitere Themen quellen aus dem Füllhorn. Auch der Einfluss von Fernsehen oder Internet auf Leselust und Lesefähigkeit wird angerissen, ebenso die Klischees vom Deutschen in anderen Ländern: harter Klang, Anmutung soldatischer Zackigkeit. Voltaire spottete schon 1750, Deutsch tauge „nur für Soldaten und Pferde”.
Bald weltweit auf
Werbetournee durch
die Goethe-Institute
Man bekommt zahlreiche kleine Denkanstöße – mit hübschen Details wie jenem Foto vom „Gastarbeiter”-Sprachunterricht der frühen 60er. Da steht an der Tafel ein zeittypisch kreuzbraver Übungssatz: „Der Herr gibt der Dame den Bleistift.” Nostalgisch auch die in langen Deutschstunden von Schülern verzierten und beschmierten Reclam-Hefte. Ein ähnliches Exemplar könnte wohl fast jeder beisteuern.
Sprache lässt sich nur umständlich bebildern, doch die Bonner lassen sich nicht lumpen. Die Erinnerung an die 50er wird etwa mit zeitgenössischen Comics und dito Kofferradios wachgerufen. Ein eigens gebauter Schreibroboter (der gleich nach Eröffnung der Schau den Geist aufgab) sollte mit metallischer Geisterhand (un)sinnige „Manifeste” zu Papier bringen, man hatte ihn mit Wortkaskaden und Satzbildungsregeln gefüttert. Immer wieder kann der Besucher sein Wissen testen – anhand von Quiz-Klappen mit aufgedruckter Frage und verborgener Antwort.
Die Schau versteht sich ausdrücklich als „Werbung” für die deutsche Sprache, sie wird anschließend einige Jahre lang vom Goethe-Institut auf Welttournee geschickt. Also gibt man zwar die eine oder andere kleine Bedrohung zu, doch im Grunde erscheint unsere Sprache als unverwüstlich und vital. Die Ausstellung gibt uns tröstlich zu verstehen: Das Deutsche habe schon manches verwunden und werde noch manches überstehen – auch steifen Bürokratenjargon, Anglizismen, SMS- oder Internet-Kürzel. Was die Sprache nicht abmurkst, kann sie bereichern.
„Man spricht Deutsch”. Haus der Geschichte, Bonn, Willy-Brandt-Allee 14. Bis 1. März 2009. Geöffnet Di-So 9-19 Uhr, Eintritt frei.
Die Sprachausstellung ergänzt die im selben Haus laufende Schau „Flagge zeigen. Die Deutschen und ihre Nationalsymbole” (bis 13. April 2009, ebenfalls Di-So 9-19 Uhr).
Die Berliner Sprachausstellung beginnt am 15. Januar 2009 im Deutschen Historischen Museum.