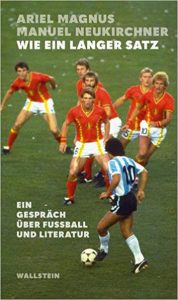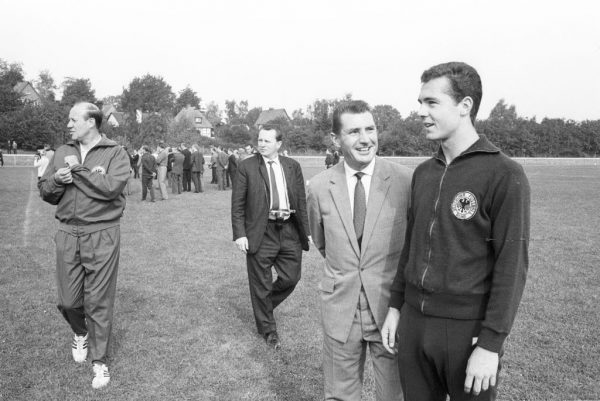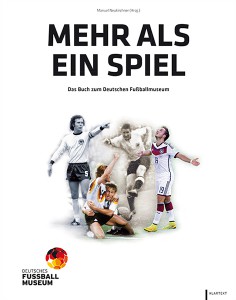Ein gelungener Pass ist wie ein gelungener Satz – Was Fußball und Literatur verbindet
Was lösen Fußball und Literatur gleichermaßen aus? Vielleicht Emotionen? Das natürlich auch. In erster Linie aber haben beide das Spielerische gemeinsam, sodass eine gelungene Pass-Stafette einer dito Satzreihe ähneln kann. Das meint jedenfalls der Schriftsteller Ariel Magnus. Zu finden sind derlei Mutmaßungen in einem schmalen Buch, das auf einem Gespräch im Deutschen Fußballmuseum zu Dortmund basiert.
Im Dialog: Manuel Neukirchner, Direktor des Museums, und Ariel Magnus, argentinisch-deutscher Schriftsteller mit spezieller Fußball-Leidenschaft, der 2021 als „Metropolenschreiber Ruhr“ – leider zu Zeiten des Lockdowns – ins Revier kam und das Dortmunder Institut nicht auslassen mochte. Etwas Derartiges, so Magnus, gebe es im fußballverrückten Argentinien nicht. Im Ruhrgebiet hat er sich nicht zuletzt mit der Rivalität zwischen BVB und Schalke befasst. Überdies hält er dafür, das Revier auch mit kennzeichnenden Klischees zu beschreiben – vom Kumpel bis zur Currywurst. Klischees müssten eben sein. Sie dienen der Orientierung und halten sozusagen den Laden zusammen.
Hat Maradona auch die Sprache bereichert?
Neukirchner führt Magnus zu ausgewählten Stationen des Fußballmuseums – vom „Wunder von Bern“ (deutscher WM-Sieg 1954) bis hin zur „Hall of Fame“. Die Exponate und Installationen regen das Gespräch über Fußball und Literatur an, wobei sich Neukirchner eher zurücknimmt, indem er vorwiegend Magnus das Wort überlässt.
Was den Fußball angeht, ist Ariel Magnus von ganzem Herzen Argentinier. Das Stadion von River Plate in Buenos Aires gilt ihm als Tempel, Diego Armando Maradona (1960-2020) als wohl größter Spieler aller Zeiten, was man weit über Argentinien hinaus, wenn nicht global bejahen kann (jedoch nicht in Brasilien, wo Pelé höher rangiert). Auf dem Cover des Buches ist zu sehen, wie Maradona gleich sechs belgische Gegenspieler in Atem hält. Apropos Spielzüge und Sätze: Maradona habe nicht nur in den Stadien begeistert, sondern auch immer wieder mit genialen Äußerungen und Wortspielen die spanische Sprache bereichert. Auf diesem Felde glänze ein anderer argentinischer Weltfußballer überhaupt nicht, behauptet Magnus: „Du wirst nie einen guten Satz von Messi finden.“
Jammerschade, dass Borges den Fußball verabscheute
Der Spielzug-Satz-Vergleich gibt dem Band auch den Titel. Magnus bekennt, den Satzbau bei Thomas Mann besonders zu lieben, so etwas vermisse er im Spanischen. In den besten Phasen deutscher Mannschaften habe es entsprechend hinreißende Passfolgen gegeben. Geradezu tragisch findet es Magnus, dass Argentiniens ruhmreichster Autor, Jorge Luis Borges (1899-1986), ein ausgemachter Fußball-Verächter war. Die deutschsprachige Literatur habe immerhin Größen wie Peter Handke und Günter Grass hervorgebracht, die mit Fußball etwas anfangen konnten. Freilich blieb auch bei ihnen der Sport literarische Episode. Ansonsten fallen noch Namen wie Ror Wolf und F. C. Delius, nicht aber Nick Hornby oder Frank Goosen. Sollte sich da eine Hierarchie andeuten?
Gottfried Fuchs, Lotte Specht und all die anderen
Magnus stellt sich vor, wie der furchtbare SS-Obersturmbannführer und KZ-Organisator Adolf Eichmann, der sich bis 1960 in Argentinien versteckte, 1954 über das „Wunder von Bern“, also den Sieg des (vermeintlich) „neuen“ Deutschland, geflucht haben muss. Ariel Magnus wurde als Kind jüdischer Einwanderer, die vor dem NS-Staat geflüchtet waren, in Argentinien geboren. Er plädiert dafür, die Geschichte deutscher Fußballer jüdischer Herkunft im Museum nicht als isoliertes Kapitel darzustellen, sondern mit dem großen Ganzen zu verknüpfen. Beispielsweise die Geschichte des Gottfried Fuchs, der 1912 bei den Olympischen Spielen einen heute noch gültigen Rekord für eine deutsche Nationalelf aufstellte: Beim 16:0 gegen Russland erzielte er 10 Tore. Menschen wie er, Julius Hirsch, Lotte Specht (1930 in Frankfurt eine Pionierin des Frauenfußballs) und viele andere wurden nach 1933 aus der (Sport)-Historie entfernt. Schreckliche Kontinuität: Noch in den 1980er Jahren fehlten sie in einem neu aufgelegten Album über jene Zeiten.
Sind Kurzgeschichten besser geeignet als Romane?
Wiederholt wird im Gespräch die Frage erwogen, ob es einen großen Fußball-Roman geben könne, der wesentlich über die Anhängerschaft dieses Sports hinauswirkt. Wohl kaum, glaubt Magnus. Wahrscheinlich eigne sich eher die Form der Kurzgeschichte. Oder halt doch die Sprache der Bilder. Womit wir wieder beim Fußballmuseum wären: Zwar haben sie dort ein Original-Maradona-Trikot von der WM 1990 (gestiftet vom einstigen BVB-Stürmer Frank Mill), doch empört sich Ariel Magnus – halb scherzhaft – darüber, dass der argentinische WM-Triumph von 1986 (3:2-Finalsieg gegen Deutschland) hier praktisch nicht stattfinde. Ob das Museum jetzt wohl nach einschlägigen Ausstellungsstücken fahndet?
Ariel Magnus / Manuel Neukirchner: „Wie ein langer Satz. Ein Gespräch über Fußball und Literatur“. Wallstein Verlag. 72 Seiten. 14 Euro.
__________________________
…und schon ist (just seit 17. Juni) Manuel Neukirchners nächstes Buch auf dem Markt, es handelt vom legendären WM-Halbfinale 1982 zwischen Deutschland und Frankreich: „Die Nacht von Sevilla. Fußballdrama in fünf Akten“, 152 Seiten, Verlag Delius Klasing, 29,90 Euro.
__________________________
Tätääää!
P. S.: Dies ist übrigens ungelogen der 5000. Beitrag in den Revierpassagen.