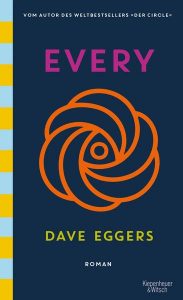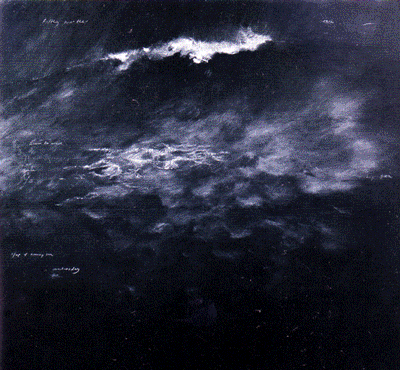Durch Apps die Welt beherrschen – Dave Eggers konstruiert mit seinem Roman „Every“ eine digitale Dystopie
Sie heißen „TellTale“ und „TruVoice“, „OwnSelf“ und „HappyNow“, „Should I“ und „Friendy“: nur einige von unzähligen kostenlosen Apps, die demnächst jeder Mensch auf seinem Smartphone hat. Sie machen aus dem Leben ein Rundum-Sorglos-Paket. Helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und uns ständig selbst zu optimieren.
Viel mehr noch: Sie beraten uns beim Einkauf, reduzieren das Überangebot und verbannen umweltschädliche Produkte. Sorgen dafür, dass unser CO2-Fußabdruck kleiner wird und wir durch bewussten Verzicht und Ressourcen schonendes Handeln das Klima retten. Verraten uns, ob wir glücklich sind und vermeintliche Freunde uns nur etwas vorflunkern. Sie hören mit und sprechen mit uns, sie wissen, was wir denken und fühlen und geben uns Ratschläge, welche Wörter diskriminierend und tunlichst zu vermeiden sind. Eine App („WereThey?“) kann ermitteln, ob unsere Eltern immer gut zu uns waren, eine andere („FictFix“) ist behilflich, unsympathische Figuren aus Romanen zu entfernen. Mit „EndDis“ können Archivare unangemessene Bilder und Texte für immer löschen.
So sieht sie aus, die schöne neue Welt, die da draußen wartet, nur ein paar Monate oder Jahre entfernt. Oder ist sie vielleicht schon da? Gibt es überhaupt noch ein „Draußen“? Wozu sollten die Menschen noch vor die Tür gehen, wenn ihnen alles ins Haus geliefert wird, wenn sie Urlaubsreisen nur noch per Video-Guide mit dem Smartphone machen, sie auf der Straße oder in der U-Bahn jeden Unbekannten mit einer App taxieren können, ob er ein Vergewaltiger oder Mörder ist?
Alle Konkurrenten geschluckt
„StayStil“ heißt eine zig-millionenfach benutzte App, die von „Every“ entwickelt wurde, dem digitalen Mega-Monopol: größte Suchmaschine, größter Social-Media-Anbieter, größter Software-Entwickler, größtes Onlineversandhaus der Welt. „Every“ hat alle Konkurrenten geschluckt und kauft jede Woche unzählige Start-Ups dazu. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft: alles Schnee von gestern. „Every“ kontrolliert die Gedanken und die Wünsche. Natürlich auch die Politik. Wer Kritik an „Every“ übt, digitale Regulierungsmaßnahme fordert und die Freiheit des Individuums anmahnt, wird über die sozialen Netzwerke sofort in die Hölle des Vergessens verbannt.
Gegen die gefährliche Machtfülle von „Every“ war die Zukunftsvision von „Circle“ nur ein ein harmloses Vorspiel: der sektenartige „Circle“ ist, so will es Autor Dave Eggers, von „Every“ einverleibt und ausgespuckt worden worden. Weil auch in der realen Welt alles noch viel schlimmer gekommen ist, als er es in seiner (allein im deutschsprachigen Raum über 600.000 Mal verkauften) „Circle“-Science-Fiction prophezeite, hat er jetzt seinen futuristischen Horror weitergedacht, das lockere Fäden-Logo von „Circle“ zum kompakten „Wollknäuel“ verdichtet, aus dessen Zentrum uns ein Auge anstarrt. Es registriert und bewertet alles. Wahrscheinlich auch die Lektüre des Romans.
Nur ein Abklatsch von Orwell und Huxley
Dass wir von Seite zu Seite genervter und gelangweilter sind, wird dem alles sehenden Wollknäuel nicht gefallen. Aber was sollen wir machen: Ein Ziegelstein-dicker Roman, der sich anschickt, Orwells analoge Alpträume ins digitale Zeitalter zu verlegen und uns vor dem endgültigen Sieg von Huxleys furchterregend schöner neuer Welt warnt, kann nur ein matter Abklatsch werden. Vor allem, weil Eggers keine Figuren aus Fleisch und Blut erfindet, die einen mitleiden lassen, keine Handlung, die einen emotionalen Schock entfacht oder einen intellektuellen Denkraum aufschließt, keine Sprache, die einen fasziniert und betört und zum Durchhalten animiert. Stattdessen nur Digital-Talk, endloses Gequassel über neue Apps und weitere Möglichkeiten, den Terror der Transparenz auf die Spitze zu treiben und den gläsernen Menschen zu kreieren, der sich in einer chaotischen, von der Klimakatastrophe Welt bedrohten Welt nach Ordnung und Sicherheit sehnt und bereit ist, seine Freiheit aufzugeben und an „Every“ abzutreten.
Doch wer ist „Every“, was will der neue digitale Welt-Herrscher? Wie könnte man seine Macht brechen und das Monstrum zerstören? Delaney Wells, ehemalige Försterin und unerschütterliche Technikfeindin, will das herausfinden, den Konzern unterwandern und vernichten. Sie schleust sich ins System ein, wird Mitarbeiterin bei „Every“, dessen Zentrale auf einer Insel in der Bucht von San Francisco liegt. Sie füttert die Firma mit Ideen, regt neue Apps an, von denen sie hofft, sie würden die User zum Widerstand anregen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Den Menschen gefällt es, von „Every“ in jeder Lebenslage beraten und bespielt, beschützt und beglückt zu werden: „Geheimnisse sind Lügen“ lautet eine der „Every“-Parolen. Weg also mit allen Geheimnissen, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten.
Bevölkert von seelenlosen Mutanten
Glauben Delaney und ihr verträumter Computer-Freund, der zottelige Späthippie Wes Kavakian, wirklich, „Every“ von innen heraus zerstören zu können? Dass es bei „Every“ eine „Widerstandsgruppe“ geben könnte, die nicht schon längst erkannt und infiltriert wurde? Wo Apps herrschen, brauchen keine Bücher und Menschen bei einer Temperatur von Fahrenheit 451 verbrannt werden. Aber natürlich platzen in diesem literarisch völlig substanzlosen Roman alle Träume von einer besseren Welt und enden in der digitalen Dystopie.
Hätte der vom technischen Firlefanz zugleich faszinierte wie erschrockene Autor nicht über unzählige Seiten Dutzende Apps erfunden und beschrieben, wäre ihm vielleicht ein spannender, aufrüttelnder Roman gelungen, bevölkert nicht von digitalen Mutanten, sondern von richtigen Menschen. Keiner, sagt einmal ein „Everyone“, die für das Kürzen und Aktualisieren von Literatur zuständig sind, will einen Roman lesen, der länger ist als 577 Seiten. Hätte fast gepasst. Mit Dank, Inhalt, Hinweis zum Autor und auf den von ihm gegründeten Verlag McSweeey´s sind es denn doch leider ein paar Seiten mehr geworden.
Dave Eggers: „Every“. Roman. Aus dem Englischen von Klaus Zimmermann und Ulrike Wasel. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021, 583 S., 25 Euro.
____________________________________
Dave Eggers und seine Vetriebskanäle
Die Bücher von Dave Eggers, geboren 1970, werden viel und kontrovers diskutiert. Sein Roman „Der Circle“ war weltweit ein Bestseller. Der Roman „Hologramm für den König“ war für den National Book Award nominiert, für „Zeitoun“ wurde ihm der American Book Award verliehen. Die Originalausgabe von „Every“ erscheint in den USA nur in dem von Eggers gegründeten unabhängigen Verlag „McSweeney´s“. Bei Amazon und anderen Handelsketten ist er zunächst nicht verfügbar. Taschenbuch, E-Book und Hörbuch erscheinen einige Wochen später im amerikanischen Verlag Vintage und werden dann auf allen Kanälen verkauft. Da die britische Ausgabe schon jetzt im deutschsprachigen Raum verfügbar ist, kann auch Kiepenheuer & Witsch den Roman vertreiben. (FD)