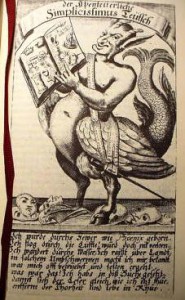Ein Fenstersturz mit unabsehbaren Folgen: Vor 400 Jahren begann in Prag der Dreißigjährige Krieg
Die Szene wirkt wie aus einem schlechten Film: Am Morgen des 23. Mai 1618 dringt ein Trupp radikaler Protestanten unter Führung des Grafen Heinrich Matthias von Thurn auf der Prager Burg in den Tagungsraum der vom Kaiser und König von Böhmen ernannten Bevollmächtigten – der sogenannten Regenten – ein.
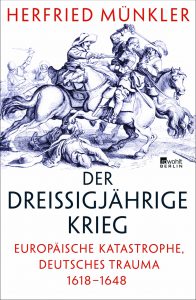
Das Werk von Herfried Münkler über den Dreißigjährigen Krieg
Dort kommt es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf die beiden katholischen Regenten Jaroslav Borsita von Martinitz und Wilhelm Slavata samt dem Sekretär Philipp Fabricius aus dem Fenster in den 17 Meter tiefen Burggraben gestoßen werden – in der Absicht, sie zu ermorden.
Die Mode der Zeit verhindert den Tod der drei: Die schweren, weiten Mäntel bremsen den Sturz, die abgeschrägten Mauern der Burg lassen die Männer wohl eher hinabrutschen als im freien Fall auf den Boden schlagen. Dass die Opfer auf einem Misthaufen weich gelandet seien, ist jedoch eine Legende.
„Urkatastrophe der Deutschen“
Der „Prager Fenstersturz“ wird gemeinhin als Beginn einer 30jährigen Serie kriegerischer Auseinandersetzungen angesehen, die erst 1648 mit dem „Westfälischen Frieden“ endete. Bis in die Zeit des Ersten Weltkriegs galt der Dreißigjährige Krieg als Urkatastrophe der Deutschen: Gewalt und Seuchen dezimierten die Bevölkerung von geschätzt 17 auf elf Millionen, die „kleine Eiszeit“ – es gab Jahre, da schneite es bis in den Juni – mit Missernten und Hungersnöten tat ein Übriges dazu.
Heerhaufen und umherziehende Marodeure verwüsteten die Felder, brannten Gehöfte und Dörfer nieder, brachten Epidemien ins Land, vergewaltigten und töteten. Der Historiker Herfried Münkler, Verfasser eines grundlegenden neuen Buchs über diese Zeit, sagt, der Krieg habe im Verhältnis „weit mehr Todesopfer gefordert als der Erste und der Zweite Weltkrieg zusammen“.
Münkler weist jedoch auch darauf hin, dass die Kriege, die zwischen 1618 und 1648 geführt wurden, nicht als Religions- oder Konfessionskriege gelten können: „Religion fungierte vor allem als Brandbeschleuniger für … politische Konflikte. Und diese Konflikte schafften wiederum die Möglichkeit, den religiösen Streit in äußerster Härte auszutragen“, sagt er in einem Interview. Die Besonderheit des Konflikts sei, so Münkler in der „Tagespost“, dass er sich „relativ früh und fast gleichzeitig mit der Konfessionsfrage verbindet“.
Der Aufstand in Böhmen war keine Volksbewegung
Der sogenannte böhmische Aufstand war keine breite Volksbewegung, sondern die Reaktion einer Minderheit Adliger auf die Politik der Habsburger: Der 1617 zum König von Böhmen gewählte Ferdinand versuchte, das Land zu rekatholisieren. Zwar hatte er die Privilegien der Protestanten bestätigt, die Politik vor Ort aber wurde als Schikane empfunden, gegen die sich immer mehr Widerstand formierte. Zudem hegte Ferdinand ein tiefes Misstrauen gegen die Stände. Die Schließung und der Abriss zweier evangelischer Kirchen 1617 führten zum Protest protestantischer Adliger, woraufhin der König weitere Versammlungen verbot.
Der Konflikt weitete sich aus, als die protestantische Opposition ein „Direktorium“ als Übergangs-Landesregierung wählte und begann, unter Führung des Grafen Thurn eine Armee aufzustellen. Die Habsburger reagierten zunächst planlos und ihre militärischen Kräfte unter Karl Bonaventura Bucquoy waren zu schwach, um sich durchzusetzen. Während Ferdinand in Frankfurt zum deutschen Kaiser gewählt wurde, schlossen sich die fünf böhmischen Kronländer (Böhmen, Mähren, Schlesien und die beiden Lausitzen) zu einer Konföderation zusammen, erklärten die Wahl Ferdinands zum König von Böhmen für widerrechtlich und wählten am 26. August 1619 den 23jährigen Friedrich V. von der Pfalz zum König.
Keine Unterstützung für den „Winterkönig“
Der Pfälzer hatte auf Unterstützung seines Schwagers, des Königs von England, und der protestantischen Union gerechnet, wurde aber bitter enttäuscht. Von seinen neuen Untertanen verstand er weder die Katholiken noch einen Teil der in zahlreiche Splittergruppen zerfallenden Protestanten. Seine streng reformierten Pfälzer Begleiter zogen sich den Unmut der Böhmen zu, als sie im Prager Veitsdom Kunstwerke zerstörten und Heiligengräber schändeten. Inzwischen beschlagnahmten die böhmischen Konföderierten katholische Besitztümer und erhöhten die Steuern erheblich, um ihre Militärausgaben zu finanzieren. Ein Vorstoß auf Wien im Winter 1619 scheiterte.
Jetzt sammelte der neu gewählte Kaiser Ferdinand seine Kräfte: Er sicherte sich die Unterstützung von Herzog Maximilian von Bayern. Im August 1620 nötigte Ferdinand den mit den Böhmen verbündeten österreichischen Ständen eine Kapitulation ab, dann marschierten die kaiserlichen Truppen unter Bucquoy und dem berüchtigten Johann T’Serclaes von Tilly in Böhmen ein. In der Schlacht am Weißen Berg am 8. November 1620, der ersten großen militärischen Auseinandersetzung des Dreißigjährigen Krieges, unterlagen Friedrich V. von der Pfalz und sein Heerführer Christian I. von Anhalt den Truppen der Katholischen Liga. Der Weg zur Entmachtung der Stände und zur Gegenreformation in Böhmen war damit frei. Friedrich V. verlor seine Erblande und die Kurwürde, die sich Maximilian von Bayern neben der Oberpfalz sicherte.
Geschürt von Extremisten auf beiden Seiten
Der Konflikt war freilich nicht zu Ende. Noch war ein „Dreißigjähriger Krieg“ nicht absehbar, aber die Kräfte des politischen Ausgleichs waren nicht in der Lage, die Eskalation zu stoppen. Der zunächst auf Böhmen und Teile Österreichs begrenzte Verfassungs- und Konfessionskonflikt wurde zum Krieg katholischer und protestantischer Mächte, geschürt von Extremisten auf beiden Seiten, Reformierten und Jesuiten. Er weitete sich aus zu einem europäischen Hegemonialkrieg, aus dem die Partei der Habsburger als der große Verlierer hervorgeht und sich europäische Groß- und Mittelmächte wie Frankreich, Schweden, aber auch Bayern und Sachsen stabilisieren und arrondieren.
Lektüre:
Herfried Münkler: „Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618-1648“. 976 Seiten. Rowohlt-Verlag Berlin. Hardcover 39,95, E-Book 29,99 Euro.
Peter H. Wilson: „Der Dreißigjährige Krieg. Eine europäische Tragödie“. 1160 Seiten. Theiss Verlag. Hardcover 49,95, E-Book 39,99 Euro.