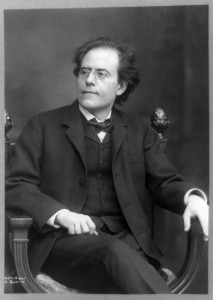Kontrollierte Verstörung: Tomáš Netopil rundet seinen Essener Mahler-Zyklus ab

Die Essener Philharmoniker bei der Generalprobe zu Gustav Mahlers Dritter Sinfonie unter dem Dirigat von Tomáš Netopil. (Foto: Volker Wiciok)
Es wäre so schön gewesen: Schon bei seinem Amtsantritt hatte sich der Essener Generalmusikdirektor Tomáš Netopil mit Mahler vorgestellt. Hätte es Corona nicht gegeben, wäre die Dritte Sinfonie der Abschluss eines Zyklus über die letzten zehn Spielzeiten geworden.
Die Erste war zum Einstand 2013 ein Versprechen für die Zukunft, das der in Přerov im Osten Tschechiens geborene Dirigent immer überzeugender einzulösen wusste. Jetzt, da sich seine Zeit in Essen zum Ende neigt, hätte er bis auf die riesenhafte Achte alle Sinfonien Mahlers mit seinem Orchester erarbeitet. Doch die Siebte, im Februar 2021 geplant, blieb auf der Strecke; die Dritte eigentlich im Juni 2020 terminiert, konnte er jetzt erst nachholen. Sie geriet zum Fest: Zunächst ein leider allzu vorwitzig auf den letzten Ton aufsetzender Klatschorkan, als Netopil seinen Arm noch in die Höhe hielt, dann langer Jubel und Begeisterung. Ein verdienter Triumph für die Essener Philharmoniker, die an diesem Mahler-Abend hingebungsvoll und hinreißend gespielt haben. Der Nachfolger Netopils, Andrea Sanguineti, hat in einem Interview bereits angekündigt, das Auge auf Mahler und Strauss zu richten. Es wird ein reizvoller Vergleich werden.

Tomáš Netopil am Pult der Essener Philharmoniker. (Foto: Volker Wiciok)
Netopil macht aus der Dritten kein brutales Schlachtfest, wetzt nicht die Klingen, um das kontrollierte musikalische Chaos zu zerfetzen. Sein Zugang war stets der gemessene, manchmal sogar elegante. Vor zehn Jahren, in der Ersten, führte das noch zu rund geschliffenen Konturen. Das Schroffe, Irritierende der Sprache Mahlers fand sich samten und seidig ausgekleidet. Die in Essen uraufgeführte Sechste – wie die Neunte auf einer CD nachzuhören – klang da schon anders, entschieden aufgeraut und zugespitzt. Jetzt, mit der 1902 beim 38. Tonkünstlerfest in Krefeld erstmals erklungenen Dritten, schafft Netopil so etwas wie eine Synthese. Das Chaos fährt nicht in zermalmendem Fortissimo auf, die Philharmoniker bleiben selbst in Momenten höchster Erregung kontrolliert statt ungezügelt furios. Aber das Doppelbödige, Verstörende dieser Musik äußert sich in der smarten Ästhetik ihrer Darbietung vielleicht noch bedrohlicher als in unmittelbarem, rabiatem Zugriff.
Grinsende Schönheit
Dass diese Schönheit satanisch grinsen kann, dass mit ätherischer Transparenz der Hauch des Fauligen hereinweht, macht Netopil an diesem Abend in der ziemlich voll besetzten Essener Philharmonie erschreckend klar. Zu Beginn tun die triumphalen Hörner so, als gäben sie ein Thema vor, aber ihr schwankendes Motiv verlischt fast folgenlos. Der bald einsetzende Trauermarsch, in dem das Fagott den Messingglanz des Blechs ärgert, hat etwas von Berlioz’scher „Fantastique“-Groteskerie. Das Pianissimo der Posaunen ist nicht geheuer; in die wiegende Wagner-Idylle der Geigen quäken die Klarinetten ihren Misston. Nach der Reprise – einer der wenigen Momente, die an das Formmodell eines ersten Satzes erinnern – driften ein Märschlein und eine ungenierte Schlagermelodie endgültig in Ironie ab.
Die Essener Philharmoniker halten den Klang offen, auch wenn sich über aufgeregte Streichertremoli ein sonores Blech-Forte legt. Selbst wenn sich Mikro-Stimmen verschlingen und verheddern, bleiben die Vorgänge durchhörbar. Der Klang plustert sich nie ins Breiige, erschöpft sich aber auch nicht in kalter Analytik. Die surrealen musikalischen Traumlandschaften ziehen in scharfen Konturen vorbei.

Bettina Ranch. (Foto: Volker Wiciok)
In der ziselierten Ornamentik des zweiten Satzes, in dem Mahler das Kunstvolle ins Verkünstelte degenerieren lässt, bewähren sich die Philharmoniker in luftigen Klanggebilden. Und wenn im vierten Satz Bettina Ranch die menschliche Stimme in flutendem Alt in die Instrumente mischt, trifft das Orchester die dunkel grundierte Atmosphäre ebenso wie in der aufgelichteten Naivität der religiösen Nazarener-Idylle des fünften Satzes.
Die zurückhaltende Damenriege des Philharmonischen Chores Essen (Patrick Jaskolka) trägt diese Klangkonzeption ebenso mit wie der Aalto-Kinderchor und der Kinderchor der Deutschen Oper Berlin (Christian Lindhorst). Nachzuhören ist dieses musikalische Weltengemälde demnächst auf einer weiteren CD der Essener Philharmoniker oder im Video-Stream. Und für den neuen Chef des Orchesters hat Netopil die Messlatte hoch gelegt: Der Startpunkt für die Spannungskurve ist da.