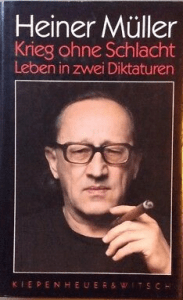„Der doppelte Erich“ – wie Kästner sich durch die NS-Zeit lavierte
Erich Kästner scheint, von heute aus betrachtet, zu den Unbezweifelbaren zu gehören. War er nicht eindeutig „links“ und somit unverdächtig, es auch nur ansatzweise mit dem NS-Regime gehalten zu haben? Wenigstens bis in die späten 1960er Jahre galt er quasi als geheiligt, und bis heute scheint sein Andenken gegen Attacken gefeit. Sind seine Bücher nicht schon 1933 auf den schändlichen Scheiterhaufen der Nazis verbrannt worden? Ja, gewiss, so war es. Und doch…
…und doch gibt es jetzt ein bedenkenswertes Buch, in dem etliche Zweifel an seiner Redlichkeit laut werden. Diese Einwände lassen sich wohl nicht so einfach beiseite wischen. Kästner, schon am Vorabend des „Dritten Reiches“ mit Büchern wie „Emil und die Detektive“ (1931) weithin berühmt, ist alle die finsteren Jahre über – bis zum „bitteren Ende“ – in Deutschland geblieben, ja, er hat in dieser Zeit (wenn auch meist unter Pseudonymen schreibend) zuweilen gar nicht schlecht verdient. Propagandaminister Joseph Goebbels ließ Kästner gewähren, als der das Drehbuch des groß angelegten Films „Münchhausen“ (Kinostart März 1943, Hauptrolle Hans Alberts) zum Ufa-Jubiläum schrieb. Mit dieser Produktion wollten die NS-Machthaber zeigen, dass der längst „abgehängte“ deutsche Film Hollywood mindestens ebenbürtig war – natürlich ein lachhafter Trugschluss. Übrigens: Erst Hitler selbst setzte der stillschweigenden Schreiberlaubnis für Kästner ein abruptes Ende.
Nach 1933 nur Harmloses geschrieben
Buchautor Tobias Lehmkuhl, Journalist u. a. für „Zeit“, „FAZ“ und Deutschlandfunk, hat erwartungsgemäß gründlich recherchiert, um Kästner auf die teilweise verdächtigen Spuren zu kommen. Zwar trägt er viele, viele Fakten zusammen, doch muss er auch immer mal wieder spekulieren. Demnach ist es dann nicht unwahrscheinlich oder einigermaßen wahrscheinlich, dass Kästner zu dem oder jenem Zeitpunkt diesen oder jenen Menschen getroffen und dieses oder jenes Thema mit ihm besprochen hat. Na, wenn das so sein soll… Da steht spürbar so manches auf tönernen Füßen.
Der Buchtitel „Der doppelte Erich“ ist eine etwas wohlfeile, aber griffige Anspielung auf Kästners Erfolg „Das doppelte Lottchen“ (erst 1949 erschienen) und überdies ein Hinweis darauf, dass dieser Autor fast durchweg Maskierungs- und Doppelgänger-Geschichten ersonnen und erzählt habe. Daraus wiederum leitet sich die hartnäckig verfolgte Annahme her, dass er selbst ein Meister im Verschleiern und im geschickten Rollenspiel war. Während des „Dritten Reiches“ hat Kästner, der zuvor den beachtlichen „Fabian“ geschrieben hatte, nur noch Harmlosigkeiten wie „Drei Männer im Schnee“ oder „Die verschwundene Miniatur“ hervorgebracht. Er war, wie es hier heißt, sozusagen ein amputierter Autor, der sich hin und wieder sogar von der unmenschlichen Sprache der Faschisten (von Victor Klemperer LTI = „Lingua Tertii Imperii“ genannt) infiziert zeigte.
Kompromisse fürs (finanzielle) Überleben
Tatsächlich muss einem längst nicht alles sympathisch oder auch nur geheuer sein, was Kästner damals unternommen und unterlassen hat. Zwar hat ihm der von den Besatzern als deutscher Kronzeuge eingesetzte Carl Zuckmayer schon 1943 eine Art Unbedenklichkeits-Bescheinigung („Persilschein“) ausgestellt, doch hatte Kästner zuvor mehrfach nachdrückliche Versuche unternommen, in die NS-geführte Reichsschrifttumskammer aufgenommen zu werden. Fürs finanzielle Überleben scheint er zu einigen (faulen) Kompromissen bereit gewesen zu sein. Er selbst stand übrigens unerkannt in hinterer Reihe dabei, als (auch) seine Bücher verbrannt wurden – und hat keinesfalls dagegen die Stimme erhoben, weil ihm sein Leben lieb war.
Nach dem Krieg hat Kästner Legenden verbreitet wie jene, dass er als einziger unter Tausenden bei einer Propaganda-Veranstaltung im Berliner Sportpalast nicht mitgesungen habe und nicht aufgestanden sei, was Tobias Lehmkuhl füglich in Zweifel zieht. Man darf wohl schließen: Ein Kurt Tucholsky, mit dem Kästner in den 20ern zusammengearbeitet hatte, war und ist sicherlich eine verlässlichere moralische Instanz als der zur Nonchalance neigende Kästner.
Schattierungen des unfreiwilligen Mittuns
Der in Zeitungs-, Literatur- und Filmszene bestens vernetzte Caféhausliterat (eine Feststellung, keine Abwertung!) Kästner hat sich den Zumutungen der Zeit oft durch seinen Charme und durch Verhandlungsgeschick zu entziehen vermocht. Weiterhin pflegte er laut Lehmkuhl seinen verfeinerten Lebensstil zwischen Tennissport und Teintpflege. So detailfreudig wird sein Verhalten und werden seine beruflichen Freundschaften seit den „Goldenen“ Zwanzigern durchgespielt, dass mancherlei Schattierungen des unfreiwilligen Mittuns sich offenbaren. Auch scheint Kästner hin und wieder Gesinnungs-Verrat an einstigen Mitstreitern verübt zu haben, womit er heftige Kritik z. B. von Walter Benjamin oder Klaus Mann (Wie sich das angepasst hat (…) bis zum morastischen Schlammgrund der Ufa-Presse“) auf sich zog. Gegen solche harschen Anwürfe nimmt auch Lehmkuhl seinen Protagonisten in Schutz. Überhaupt ist er bemüht, möglichst Mittelwege einzuhalten. Auch damit entspricht er seinem Thema, das man wahrscheinlich nicht anders als schwankend schildern kann.
Fragen zur „Inneren Emigration“
Ein eigenes Kapitel ist Kästners ebenfalls zwiespältigem Verhältnis zu Frauen gewidmet. Der Mann, der allzeit sein Dresdner „Muttchen“ (freilich arg geschönt und verharmlost) brieflich auf dem Laufenden hielt, gestand – damals keine Selbstverständlichkeit – seinen zahlreichen Liebschaften zwar einen eigenen Kopf und eigene Freiheiten zu, ließ aber gelegentlich Frauenverachtung durchblicken. Auch dafür bringt Lehmkuhl passende Belegstellen bei. Mit Treue hatte Kästner es eh nicht. Beispiel: Just als eine Gefährtin beim Autounfall verstarb, lag er mit einer anderen zu Bette. Etwas küchenpsychologisch werden folglich Vermutungen über seine Beziehungsunfähigkeit angestellt.
Noch einmal wirft dieses Buch häufig gestellte Fragen zur „Inneren Emigration“ auf, die auch anhand anderer Zeitgenossen (Gottfried Benn, Axel Eggebrecht etc.) aufgeworfen werden, wobei u. a. die wirklichen Emigranten Thomas Mann und Theodor W. Adorno als moralische Maßstäbe angelegt werden. Auch dabei gibt es kein reines Schwarz oder Weiß, es geht um vielerlei Grautöne. Hatte Kästner anfangs vielleicht wirklich noch angestrebt, einen größeren Roman übers „Dritte Reich“ zu verfassen und eben deshalb im Lande zu bleiben, so sind kaum Notizen für ein solches Projekt erhalten – geschweige denn, dass ein veritables Werk dieser Art entstanden wäre. Nur: Konnte jemand unter vergleichbaren Bedingungen wesentlich anders handeln als Kästner?
Gar lange lässt eine Schilderung von Kästners Nachkriegs-Existenz auf sich warten, die dann leider auch etwas knapp ausfällt. Speziell hätte mich zum Beispiel Kästners patenschaftliche Rolle bei Gründung des legendären Satiremagazins „Pardon“ (1962) interessiert. Aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Kapitel.
Tobias Lehmkuhl: „Der doppelte Erich. Kästner im Dritten Reich“. Rowohlt Berlin. 305 Seiten, 24 Euro.