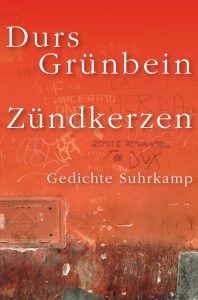Gegen Diktatur half keine Kunst – Durs Grünbeins Kriegsbuch „Der Komet“
Mit 16 hat Dora bäuerliche Armut und dumpfe Enge ihrer schlesischen Heimat verlassen und ist mit ihrem Freund, dem Metzger Oskar, nach Dresden gezogen. Sie leben bescheiden und erschaffen ihren beiden Töchtern ein kleinbürgerliches Paradies.
Das Geld reicht aus, um in den Tierpark zu gehen und die Kunstschätze der Kulturmetropole zu bewundern. Von Politik halten sie sich fern. Das Gebrüll Hitlers ist ihnen suspekt. Vor dem Schicksal der mitleidlos vertriebenen Juden schließen sie aber die Augen. Und die mit dem Krieg am Horizont aufziehende Katastrophe wollen sie nicht wahrhaben. Obwohl die Front näher rückt und viele deutsche Städte bereits in Schutt und Asche liegen, glauben sie an die Unantastbarkeit und Unverletzlichkeit ihrer glorreichen Stadt.
Dann, in der Nacht auf den 13. Februar 1945, geschieht das Unfassbare: „Mit einem tiefen, gleichmäßigen Brummen kündigte sich das Unheil an, ein gigantischer Schatten senkte sich über die Stadt, der Flügel einer großen Umnachtung.“ Während die Sirenen Alarm schlagen, schweben Fliegende Festungen der Alliierten Richtung Elbtal, öffnen Klappen und Schächte und klinken aus, was sie mitgeführt haben und abliefern sollen: „das ganze perfekt aufeinander abgestimmte Arsenal für ein konzertierten Flächenbombardement, darauf berechnet, den finalen Feuersturm zu entfachen.“
Durch die Ruinen der Stadt irren
Die mit Scharlach auf der Quarantänestation des Dresdner Krankenhauses untergebrachte Dora wird diesen „Weltuntergang“ überleben. Während die Erde bebt, die Häuser zu Staub zerfallen und zehntausende Tote am Wegesrand liegen, wird Dora durch die Ruinen der Stadt irren und sich zu ihren von einer Freundin ins nahe gelegene Pirna gebrachten Kinder durchschlagen. Auch Oskar, der als Koch seinen Dienst an der Ostfront leistet und Zeuge vielfacher Morde ist, entkommt der Apokalypse.
Von seinem Großvater und von seiner Mutter, die als kleines Mädchen beinahe von Sowjet-Soldaten nach Russland verschleppt wurde, hat der in Dresden geborene und sein langem in Berlin und Rom lebende Durs Grünbein in seinem Erinnerungsbuch „Die Jahre im Zoo“ berichtet. Jetzt, in seinem Roman „Der Komet“, steht die Überlebens-Geschichte der Großmutter im Mittelpunkt seines Interesses.
Geblendet vom früheren Ruhm
Der Büchner-Preisträger webt einen literarischen Teppich aus den Erinnerungen und Erlebnissen der Großmutter und seinen eigenen politischen und historischen Recherchen. Grünbein entwirft das Bild einer ebenso starken wie naiven Frau, das Porträt einer Stadt, die sich vom Ruhm der Vergangenheit blenden ließ, und das Sittenbild eines Volkes, das durch Willkür und Gewalt gleichgeschaltet wurde und den nationalsozialistischen Terror geduldet und mitgetragen hat.
Weder märchenhafte Mythen, noch die Schönheit der Kunst oder die „formvollendeten, endgültig ausgereiften Verse“ haben geholfen, das Unfassbare zu verhindern. Gegen Diktatur und Barbarei helfen weder die Kunstschätze im Grünen Gewölbe noch die im Villenviertel „Weißer Hirsch“ geschmiedete Poesie. Seit 1910 am Himmel der Komet Halley erschien und nur knapp an der Erde vorbei schrammte, hat sich die Angst vorm Weltuntergang tief ins Gedächtnis gegraben. „Jetzt kommt er, der Komet, das alles verheeren wird“, denkt Dora, als der Feuersturm losbricht. Und Grünbein ergänzt trocken: Nun ist „der Spaß zu Ende“, erfährt man, was das heißt: „der totale Krieg.“
Durs Grünbein: „Der Komet“. Suhrkamp-Verlag, 286 S., 25 Euro.