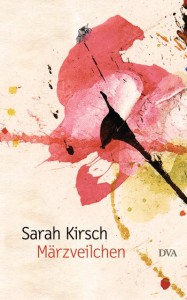Südwärts ins Klischee der 70er Jahre – Klaus Modicks Roman „Fahrtwind“
Da stößt jemand beim Sortieren seiner Bücher auf eine Lektüre, die ihn in den 1970er Jahren beeindruckt hat. Beim zerfledderten Büchlein, in dem er seinerzeit die besten Stellen mit Zigaretten-Blättchen markiert hat, handelt es sich um „Aus dem Leben eines Taugenichts“, jene berühmte Novelle des Joseph von Eichendorff aus den frühen 1820er Jahren.
Besagter Jemand erinnert sich, dass er sich damals angesprochen gefühlt hat vom Eichendorffschen dolce far niente, von herrlicher Nichtsnutzigkeit also, die auch ihm damals als Lebensmodell vorgeschwebt hat – weitaus mehr jedenfalls als die trübe Aussicht, die Klempnerfirma seines Vaters mit dem Attribut „& Sohn“ fortzuführen. Also machte er sich auf den Weg, um das süße Nichtstun zu erproben, per Anhalter (ja, das gab’s noch) ging’s südwärts.
Trampen mit Gitarre
Damit beginnen ein paar pikareske Abenteuerchen in den Freiheit verheißenden frühen Siebzigern. Der junge Ich-Erzähler, der wohl dies und jenes mit dem 1951 geborenen Autor Klaus Modick gemein haben dürfte, packt also vor allem seine Gitarre ein, trampt los und überlässt sich den Zufällen. Dabei zieht ihn allemal das Ewigweibliche hinan – oder gelegentlich auch herab.
Doch, ach, es ist nicht der junge Mann von damals, der hier frischweg berichtet, sondern ein spür- und lesbar gereifter Herr, dessen Sichtweisen mitunter etwas altväterlich anmuten. Wenn er auf Seite 17 einen schwulen „Handelsvertreter für Herrenkosmetik“ beschreibt, der ihn beim Autostopp mitnimmt und sein Knie statt der Gangschaltung tätschelt, klingt es eher nach Stammtisch der 70er, als nach Jugendaufbruch jener Zeit.
Spinatwachtel, aus dem Leim gegangen
Auf Seite 19 merken Lesende womöglich schon wieder leicht irritiert auf. Denn auch der Blick auf gewisse ältere Damen ist nicht nur ungalant, sondern so gar nicht von männlichen Selbstzweifeln angekränkelt. Zitat: „Die andere hätte ihre Mutter sein können, war im Gesicht noch einigermaßen knitterfrei oder jedenfalls knitterfrei geschminkt, in den Hüften allerdings stark aus dem Leim gegangen.“ Derlei Perspektiven und Formulierungen schmälern tatsächlich das Lesevergnügen, das sich denn auch nur streckenweise einstellt.
Der Erzähler wird also im todschicken Mercedes-Roadster aufgegabelt von einer Schönen und deren Mutter, die ihn in ein unsägliches Hippiekitsch-Kostüm zwängt und gegen Honorar für Greise in einem Luxushotel bei Wien aufspielen lässt. (Anmerkung: Greise von damals haben höchstwahrscheinlich andere Musik hören wollen). Der Erzähler bildet sich jedenfalls ein, dass die schöne Tochter nach ihm schmachtet. Doch statt dessen ist die Mutter – als „mannstolle Matrone“ und „Spinatwachtel“ tituliert – hinter ihm her. Wie unangenehm. Schon allein sprachlich. Als die schöne Tochter hingegen den Erzähler verschmäht, ist seines Bleibens nicht länger. Der wahre Süden liegt ja auch nicht bei Wien, sondern – wie immer schon seit Goethe – in Italien.
Joints und Pop und Peace
Es werden im weiteren Verlauf jede Menge Joints gedreht und geraucht, zwischendurch sind auch schon mal Psychopilze („Narrische Schwammerln“) an der Reihe. Via Namedropping kommen etliche Popsongs von damals ins Spiel – und leider auch ein paar deutsche Texte, die der Gitarrero selbst gedrechselt hat. Ansonsten halt pastos aufgetragene 70er Jahre, zuweilen arg klischeebehaftet. Was klebt auf einem VW-Bus? Der Schriftzug „Make Love not War“ natürlich, samt Pril-Blumen, Peace-Zeichen und provokanter Zunge à la Rolling Stones. Und manches mehr. Danke. Das genügt.
Auch das Thema Homosexualität wird hie und da nochmals aufgegriffen, speziell in Gestalt zweier schwuler Motorradfahrer namens Billy und Wyatt (in Wahrheit Leo und Guido, aber die amerikanischen Namen spielen halt auf „Easy Rider“ an), die noch ein paar Vertauschungs- und Verwechslungs-Rätsel bereithalten, was die Binnenspannung der Geschichte jedoch kaum wesentlich steigert. Später geistert gar ein weiterer, bis zur Parodie effeminiert dargestellter Schwuler namens – Achtung! – Detlef herum. Ich hätte gedacht, dass just diese Namenswahl in diesem Kontext eigentlich nicht mehr geht. Da hab‘ ich mich wohl getäuscht, oder?
Dann eben Natalie statt Aurelie
Fürs Finale geht die Fahrt nach Rom, wo ein Künstler mit dem verballhornten Ibsen-Namen „Peer Gynter“ die reiseführende Rolle spielt. Er nimmt den Erzähler mit zur legendären Villa Massimo, wo seit Jahrzehnten deutsche Kulturschaffende aller Sparten ihre staatlich spendierten Stipendien genießen – ein Umstand, der dem eingangs erwähnten süßen Leben sehr nahe zu kommen scheint. Auch dies eine recht schlichte Vorstellung. Wie gut jedoch, dass die kaum minder ansehnliche Schwester der vormals erwähnten Schönen auftaucht und willig ist. Natalie statt Aurelie. Was soll’s. Hauptsache knackig.
Ein Happy End für so ziemlich alle Beteiligten folgt auch noch – wie einst bei Eichendorff, bei dem es schließlich hieß „– und es war alles, alles gut!“ So lautet auch Modicks letzter Satz. Womit er etwas mit Eichendorff gemeinsam hätte.
Ganz ehrlich: Ich habe Klaus Modick öfter als stets recht soliden, verlässlichen und unterhaltsamen Autor der „gehobenen Mittelklasse“ schätzen gelernt. Diesmal bin ich etwas enttäuscht.
Klaus Modick: „Fahrtwind“. Roman. Kiepenheuer & Witsch. 208 Seiten, 20 Euro.