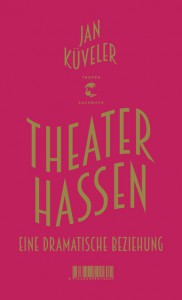Zornige Suada – längst nicht nur gegen die Finanzbehörden: Elfriede Jelineks „Angabe der Person“
Seit Elfriede Jelinek den Literaturnobelpreis erhielt, hat sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Es schien, als sei sie in ihrem Werk verschwunden und sie lebe nur noch in ihren Texten. Umso überraschender, dass es Claudia Müller gelang, die scheue Autorin mit der Kamera zu begleiten und das filmische Porträt „Die Sprache von der Leine lassen“ zu realisieren. Kaum ist der Film in den Kinos, legt Elfriede Jelinek nach und veröffentlicht einen neuen Text: „Angabe der Person“. Der Verlag kündigt an, das Buch sei die „Lebensbilanz“ der Autorin. Stimmt das?
Tatsächlich benutzt Jelinek einmal das Wort „Bilanz“ und schreibt: „Ich ziehe Bilanz, obwohl es dafür zu früh ist.“ Sie meint aber damit nicht, dass sie ihr Leben bilanzieren will. Dann müsste sie vieles thematisieren, ihre schwierigen Beziehung zu den Eltern, ihre Nervenzusammenbrüche, ihre zeitweilige Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei Österreichs, ihre zornigen Dramen und wütenden Romane, die oft für Skandale sorgten.
Es geht Jelinek um etwas anderes: um den Staat, der willkürlich in das Leben einzelner eingreift, unkontrollierte Steuerbehörden, die sich aus unerfindlichen Gründen an einzelnen Personen festbeißen. Der Satz lautet denn auch vollständig: „Ich ziehe Bilanz, obwohl es dafür zu früh ist, ich zahle also das, was des Staates ist, ich zahle meine Steuern, das wird Ihnen jeder nachweisen können, der Ziffern voneinander unterscheiden kann.“
Es macht sie rasend, dass die Steuer-Behörden sie regelrecht verfolgen und zermürben. Die Autorin pendelt seit Jahrzehnten zwischen Deutschland und Österreich, sie hat zwei Wohnsitze, einen in München, wo ihr kürzlich verstorbener Ehemann lebte, und einen in Wien, wo sie sich zumeist aufhält und in ihre Schreib-Einsamkeit zurückzieht. Die Finanzbehörden unterstellen offenbar, sie habe ihre Einnahmen nicht ordentlich versteuert und eröffnen ein Ermittlungsverfahren gegen sie, beschlagnahmen private Unterlagen, sichten sämtliche Konten, machen eine Hausdurchsuchung bei ihr, schnüffeln sich durch intime E-Mails.
Sie fühlt sich gedemütigt und zur Verbrecherin abgestempelt, obwohl sie sich keiner Schuld bewusst ist und alle Schulden längst beglichen hat: „Schuld“ und „Schulden“, ihr Lebens-Thema. Es geht ihr nicht um ihre eigenen Geldsorgen oder Steuer-Probleme, sondern um die historische „Schuld“ einer von Nazis verseuchten Gesellschaft, um die „Schulden“ von Steuer-Sündern, die ihre Geschäfte in Steuer-Oasen verlagern, es geht um Sparmodelle, Betrugsskandale, Cum-Ex-Geschäfte. Das macht sie wütend, so wird aus ihrem Zorn über die gegen sie laufenden Ermittlungen ein Nachdenken über globale Kapitalströme und über einen Kapitalismus, der keine Moral kennt, sondern nur den Imperativ des Profits: Wie sehr, fragt sich Jelinek, profitieren bis heute Staaten von enteigneten jüdischen Vermögen? Wie viele Nazi-Größen wurden anstandslos entschädigt, während die Opfer von Terror und Enteignung bis heute vergeblich auf Wiedergutmachung warten?
Elfriede Jelinek hat noch nie so offen und einfühlsam über die Geschichte des jüdischen Teils ihrer Familie gesprochen: Jetzt schreibt sie zum ersten mal über eine in Auschwitz ermordete Tante, einen Onkel, der nach Dachau deportiert wurde und, kaum wieder freigelassen, Selbstmord beging. Sie spricht vom Vater, der im Nazi-Jargon als „Halbjude“ galt und der Vernichtung nur entging, weil er als Ingenieur für die Kriegsindustrie gebraucht wurde: „Hätte das deutsche Land, das damals einfach überall war, noch länger, tausend Jahre mindestens, sich breiter aufgestellt, als meine Eltern es aushalten konnten, dann gäbe es mich nicht. Hätte das Land länger, als es mußte, auf garantiert rassereinem Nachwuchs bestanden, gäbe es mich nicht, meine Rasse ist unrein, ich weiß, ich gehöre nirgends dazu.“
Pandemie, Flüchtlinge, Religion, Philosophie, Kunst, Heidegger, Nietzsche, Freud und Camus. Nichts wird geordnet. Der 190-seitige Text ist eine unaufhörliche Suada der Empörung, ein unablässiger Gedankenstrom. Er öffnet die Tür in surreal anmutende Wirklichkeiten. Vieles klingt grotesk und ist doch fürchterlich wahr, vermischt sich zu einer absurden Collage und einem vielstimmigen Chor. Oft weiß man nicht, wer spricht, die Autorin oder der Geist des toten Vaters, ein Cum-Ex-Betrüger oder ein Jungspund aus der Polit-Riege um Österreichs Ex-Kanzler Kurz. Man weiß nur: Es ist ein schwer lesbarer und schwer verdaulicher, aber ungemein wichtiger und unverzichtbarer Text.
Elfriede Jelinek: „Angabe der Person“. Rowohlt Verlag, 190 S., 24 Euro.
Nachspann:
Elfriede Jelinek, geboren 1946, aufgewachsen in Wien, hat für ihr Werk viele Auszeichnungen erhalten, u. a. 1998 den Georg-Büchner-Preis und 2004 den Literaturnobelpreis. Zu ihren bekanntesten Werken zählen die Romane „Die Klavierspielerin“ (1983), „Lust“ (1989) und „Gier“ (2000) sowie ihre Theatertexte „Raststätte“ (1994), „Ein Sportstück“ (1998) und „Ulrike Maria Stuart“ (2006). Ihr Ehemann, Gottfried Hüngsberg, der früher für R. W. Fassbinder Filmmusiken schrieb und seit Mitte der 1970er Jahre als Informatiker tätig war, verstarb vor wenigen Wochen. (FD)