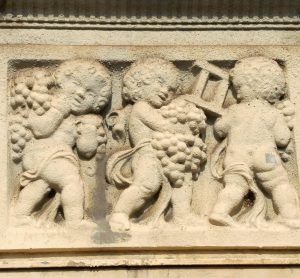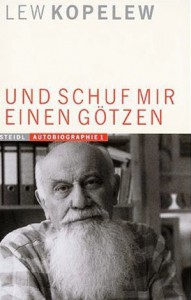Gedenktag von großem Gewicht: Im nächsten Jahr werden wir an die 1918 ausgerufene Weimarer Republik erinnert
Gedenktage gibt es ja mittlerweile in Unmengen, und dank Wikipedia kann man sich für jeden Tag des Jahres ein Gedenken aussuchen. Allerdings sind diese Anlässe nicht alle in ihrer Bedeutung gleichwertig, und deshalb ist ihre historische und faktische Einordnung auch die Aufgabe guten Journalismus‘.
In diesem Jahr sind besonders drei historische Ereignisse hervorzuheben, weil sie nachhaltige Auswirkungen hatten. Das ist zum einen Martin Luthers Anti-Papst-Handlung vor 500 Jahren, die inzwischen fast bis zum Überdruss erörtert wurde.
Das Zweite Ereignis von Bedeutung war vor hundert Jahren, im Sommer 1917, der Eintritt der Vereinigten Staaten von Amerika in den Ersten Weltkrieg und damit die Wende zur endgültigen Niederlage der deutschen Reichswehr.
Als Drittes muss man die Oktoberrevolution 1917 in Russland nennen, die letztlich in der mörderischen Stalin-Diktatur endete und in deren Folge später die DDR entstand – ein erst 1989 überwundener undemokratischer Polizeistaat.
Und wo bleibt das Positive? Das kommt bestimmt im nächsten Jahr, denn dann können wir den Beginn der ersten echten Demokratie auf deutschem Boden vor einhundert Jahren feiern, die von den Sozialdemokraten am 9. November 1918 ausgerufene Republik, die später wegen des Tagungsortes des Parlaments „Weimarer Republik“ genannt wurde.
Die SPD bereitet sich auf Bundesebene bereits auf das Jubiläum vor – schließlich spielte sie damals die Hauptrolle, und ihr Vertreter Friedrich Ebert wurde der erste Reichspräsident.
Auch auf regionaler Ebene gibt es historische Forschungen, zum Beispiel über das Wirken der Arbeiter- und Soldatenräte, die sich im Laufe der Novemberrevolution bildeten und die Anfang 1919 gewaltsam ausgeschaltet wurden.
In Großstädten wie Dortmund bestimmten die Räte wochenlang das öffentliche Wirken, in Kleingemeinden findet man nur Randnotizen über ihre Arbeit. Im Protokollbuch der Gemeindevertretung Milspe zum Beispiel, heute Teil der Stadt Ennepetal, gibt es nur einmal eine Eintragung vom 18. November 1918, als neben den Gemeindevertretern auch der spätere Reichstagsabgeordnete Walter Öttinghaus „als Arbeiter- und Soldatenrat“ das Sitzungsprotokoll mit unterschrieb.
Die neue demokratische Republik war natürlich gefährdet, und als im März 1920 mit dem Kapp-Putsch der Angriff von rechts begann, gab es auch im Ruhrgebiet zahlreiche Tote. Zwei junge Männer aus Milspe, Max Fuchs und Artur Klee, wurden bei Kämpfen mit den Putschisten am Bahnhof in Remscheid erschossen. Die Gemeindevertretung ließ sie in einem Ehrengrab bestatten, und als Rechtsnachfolgerin hat sich auch die Stadt Ennepetal zur weiteren Grabpflege verpflichtet – als sichtbares Zeichen für eine Demokratie, die mit der Ausrufung der Republik in Berlin vor beinahe 100 Jahren begann und die mit der NS-Diktatur schon 1933 ihr Ende fand.