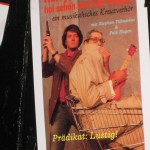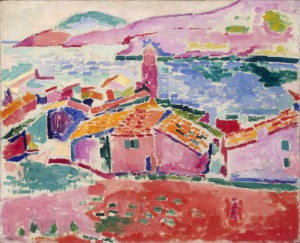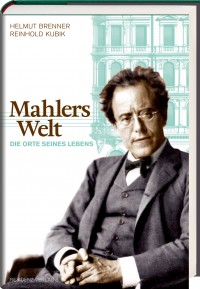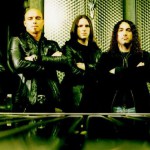Bürgerliches Trauerspiel und symbolistisches Drama: Debussys „Pélleas et Mélisande“ in Essen und Frankfurt
Mit „Pelléas et Mélisande“ bewegen wir uns im Spannungsfeld zwischen einem bürgerlichen Familiendrama, das an Ibsen erinnert, und einem symbolistischen Mysterium, das sich in bildmächtige poetische Seelenlandschaften vertieft. Die beiden profilierten Neuinszenierungen der vergangenen Wochen in Essen und in Frankfurt nähern sich Claude Debussys rätselvoller musikalischer Fassung des Dramas von Maurice Maeterlinck mit unterschiedlicher Perspektive.

In den magischen Licht-Räumen Raimund Bauers und Olaf Freeses: Mélisande (Michaela Selinger) und Pelléas (Jacques Imbrailo). Foto: Baus, Aalto-Theater Essen.
Nikolaus Lehnhoff in Essen rückt die traumverwobene Atmosphäre in den Vordergrund. Die Figuren scheinen kaum aus sich heraus zu agieren, wirken oft statisch und wie gebremst vom lähmenden Gespinst bedeutungsvoller Zeichen und Zusammenhänge. Claus Guth in Frankfurt dagegen schaut auf die Psychologie der Personen, gibt ihren Aktionen und Reaktionen etwas Welthaftes, Eindeutiges mit. Er negiert den symbolistischen Hintergrund der Oper nicht, aber er zieht sich nicht auf den Topos des Unerklärbaren zurück, sondern bindet dessen Chiffren ein in die Entwicklung des Geschehens, das zu Tod und innerem Zusammenbruch führt.

Verlöschen im Dunkel: Christiane Karg (Mélisande) und Christian Gerhaher (Pelléas) in Frankfurt. Foto: Monika Rittershaus.
Für Guth ist Mélisande kein geheimnisvolles Undinen-Wesen aus dem Irgendwo, sondern eine offenbar traumatisierte junge Frau, die zitternd versucht, sich eine Zigarette anzustecken, als sie in den Lichtkegel der Bühne tritt. Ihre Vorgeschichte bleibt im Dunkel, ihre psychische Verfassung ist es nicht. In Zuge des Dramas verdichten sich die psychologischen Motive, für die Guth die symbolistischen Züge des Dramas einsichtig verengt: Er will nicht das wabernde Ungefähr des Ahnungsvollen bebildern, sondern die Menschen in den elegant eingerichteten Räumen des zweistöckigen Hauses auf der Bühne Christian Schmidts stringent entwickeln – allerdings ohne die komplexen und rätselvollen Seiten ihrer Psyche eilfertig wegzuerklären. Warum sich die Lichtkreise Golauds und Mélisandes schon bei ihrer ersten Begegnung nicht berühren, warum sich Pelléas und die junge Frau finden und in der undurchdringlichen Schwärze des Raums in ihren Lichtauren verbinden, bleibt letztlich ein Geheimnis.
Auf der anderen Seite entwickelt Guth im Spiel präzise und faszinierend die Brennpunkte, in denen die Personen des Dramas interagieren: Der Dialog zwischen dem resignativen Pelléas, der im Selbstgespräch nur punktuell zum „Du“ durchdringt, und dem nahezu perfekt verdrängenden Patriarchen Arkel ist großes, reflektiert durchdrungenes Schauspiel. Ebenso die genau beobachtete Szene, in der Golaud versucht, mit Hilfe des Kindes Yniold die Beziehung zwischen Pelléas und Mélisande zu ergründen.
Guth achtet scharfsichtig auf versteckte Motive, deutet zum Beispiel die Szene, in der Pelléas vom Haar Mélisandes in Ekstase versetzt wird, als inneren Vorgang des in sich verschlossenen Mannes, dem die Frau tiefere Schichten seines Begehrens erschließen hilft. In Christian Gerhaher hat Guth den idealen Darsteller depressiv-verschlossener Innenwelten, dessen hoher Bariton zu unendlichen Schattierungen des Ausdrucks fähig ist. Die Mélisande Christiane Kargs erschöpft sich nicht im zerbrechlich-passiven Opfer, sondern ist eine Frau, die sehr wohl versucht, im Beziehungsgeflecht von Haus Allemonde ihre Position zu finden.
Die mühsam unterdrückte Aggressivität, mit der Paul Gay den Golaud zeichnet, bricht sich in einem ungeschönt inszenierten Ausbruch von Gewalt freie Bahn – einer Brutalität, die Mélisande wie Golaud selbst zu Opfern macht. Arkel schaut weg: Alfred Reiter gelingt trotz eines wabernd-gedeckten Basses eine beklemmende Studie von Verdrängung und uneingestandener Einsicht. Zutiefst verunsichert durch Mélisandes geschichtslose Reinheit, erinnert Golaud an den Major in Strindbergs „Vater“, gefangen im Wahntrauma der Patriarchen von der „verbotenen“ Liebe, dem uneinnehmbaren Rest weiblicher Souveränität.
Friedemann Layer und das Frankfurter Opernorchester bestätigen den auch musikalisch führenden Rang der Rhein-Main-Oper unter den deutschen Musiktheatern. Layer ist ein Sachwalter von Debussys Modernität, entdeckt nicht nur die Raffinesse der Klänge, sondern auch ihre Reibungen, ihre herbe Würze. Doch er zwingt ihnen keine Spaltklang-Sprödigkeit auf, wie sie Propagandisten eines neuen Debussy-Bildes vertreten.
Layer stützt in den wundervoll modellierten Akkordsäulen und den filigranen Rückungen im Klangverlauf die Statik von Debussys musikalischer Architektur und entdeckt ihre dramatische Funktion, die geschichtslosen Zustände der Bilder auf der Bühne abzusichern. Dass Guth dazu immer wieder eine Uhr ticken lässt und damit die verfließende Zeit als spannungsreiches, drängendes Element einführt, gehört zu den aussagestarken Details dieser – aus der Perspektive des bürgerlichen Dramas – modellhaft gelungenen Deutung, an der Layer mit seinen scharfsinnig beleuchteten Korrespondenzen zwischen Musik und Bühne erheblich Anteil nimmt.
In Essen sind die Perspektiven anders, aber nicht minder überzeugend. Denn Stefan Soltesz im Graben macht mit den Essener Philharmonikern schon in den einleitenden Akkorden, in den mysteriös eingefärbten Pianissimi der tiefen Streicher und den ersten, fahlen Holzbläserklängen seine ästhetische Position klar: Das soll ein Debussy der äußersten Verfeinerung, des raffinierten Details, der subtilen Klangmischungen werden. Die Verheißung wird glänzend erfüllt; der orchestrale Zauber entfaltet sich dank der vorzüglich auf ihren Dirigenten reagierenden Musiker mit aller Nuancierung in Farbe und Dynamik.
Ähnlich sensibel für atmosphärische Rückungen agiert Lehnhoff in seiner Inszenierung. Der hohe, kühl-dunkle Raum von Raimund Bauer, immer wieder neu ausgedeutet vom Licht Olaf Freeses, lässt naturalistische Anmutung bald hinter sich: Aus der hohen, dunklen Vertäfelung eines Saals mit der erdrückenden Noblesse der Villa Hügel wird ein Seelenraum, ein innerliches Gefängnis, aus dem Mélisande tastend, aber vergeblich einen Ausweg sucht, den sich nur das visionäre Licht, nicht aber die schwere Materialität der Körper öffnen kann. Das achte Bild mit seinen riesigen, nach unten führenden Treppen gemahnt an die Gefängnisse des Piranesi, tiefenpsychologisch radikalisiert und in eine schaurige Raumvision eines existenziellen Abgrunds verwandelt.
Auch Lehnhoff wirft einen Blick auf das bürgerliche Drama, inszeniert es aber weniger fest umrissen als sein Kollege Claus Guth in Frankfurt. Seine Annäherung an die symbolistischen Verdichtungen Maeterlincks bleibt allerdings oft unbestimmt – oder verliert sich, wie im siebten Bild die langen Haare Mélisandes, in zu konkret realisierten Bildern. So bleibt Michaela Selinger in der Hauptrolle ein verlorenes Wesen zwischen möglichen Konzepten, passiv und konturlos den Ereignissen ausgeliefert. Mit Vincent le Texier hat Essen einen kraftvollen, manchmal leider arg vordergründig bellenden Golaud, der seine Figur am Ende immer mehr in die Richtung des Gesellschaftsdramas entwickelt.

Konkretisierte Symbole: Die Haare der Mélisande in der Bildidee der Essener Inszenierung. Foto: Aalto-Theater Essen.
Auch der schönstimmige Jacques Imbrailo bleibt als Pelléas eher ein passives Wesen, unheilvoll verstrickt in die lastende Atmosphäre des Hauses. Wolfgang Schöne als Arkel und die mit grandios gereifter Stimme singende Doris Soffel als Geneviève sind die erstarrten, untoten Bewohner dieses unheilvollen Raumes; ihre Rolle wird sinnfällig unterstützt durch die Kostüme von Andrea Schmidt-Futterer, die sich im historisierenden und in einem zeitlos eleganten Arsenal von Ausdruckswerten bedienen. Getragen von wunderbar geatmeten Linien, von den bis zum Verlöschen gedämpften Piano-Schattierungen der Musik und der gestalterischen Raffinesse des Dirigenten können sich die Sänger drucklos frei entfalten. Und staunend ob dieses ästhetischen Wunders gewinnt der Satz Arkels noch eine Bedeutung über das Drama hinaus: „Man bedarf der Schönheit, wenn der Tod neben einem steht.“