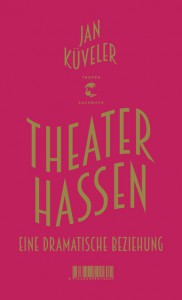So also standen damals die Dinge – Bilder schlürfen, Dialoge trinken auf filmischen Zeitreisen in die 60er und 70er Jahre
In den letzten Wochen und Monaten habe ich zuweilen Streaming-Dienste wie vor allem den auf deutsche Filme spezialisierten Auftritt alleskino.de in Anspruch genommen, um mich auf cineastischem Wege in die späten 60er und frühen 70er Jahre zurückzuversetzen. Warum nur?
Es war die Zeit, in der man sein bisschen Bewusstsein herausbildete, in der man sich aber stark und gelegentlich sogar unbesiegbar fühlte, was natürlich auch den einen oder anderen „Kater“ nach sich zog.
Wie sehr ist das alles mit der Zeit geschwunden! Wie kopfschüttelnd und zugleich verständnisinnig sieht man heute die Jungen sich am Weltenlauf abarbeiten.
Nun trinkt, schlürft und inhaliert man geradezu die Signaturen jener alten Zeiten, in denen man selbst so sehr nach vorne schaute. Musikalisch sowieso. Doch auch im Lichtspiel: Man scannt gleichsam jedes einzelne Bild. So also haben die Lichtschalter und Hinterhöfe ausgesehen. So die Möbel. So die Kleidungsstücke. So die Tapeten. So die Autos. So die Straßen und Gebäude. Wie man damals redete und sich gab…
Deutlicher und dringlicher als heute
Und man war ja selbst mitten darin, wohl deutlicher und dringlicher als heute. Eigentlich unfassbar. Es war Botho Strauß, der gegen Ende des Jahrzehnts in seinem Theaterstück „Groß und klein“ (1978) den nachmals legendären Satz prägte: „In den siebziger Jahren finde sich einer zurecht!“
Es war ein anderes Deutschland damals. Es war anscheinend alles noch so einfach und vergleichsweise übersichtlich verteilt. Wie war das denn noch ohne Handy, Computer und all das Zeug? Wie war das mit den Schreibmaschinen? Man weiß ja kaum noch, wie das gegangen ist. Und was hat man damals versäumt? Wie wirklich und unwirklich hat man gelebt; keineswegs so, wie es einem im Kino vorkommt.
Auf den Spuren von Rudolf Thome
Besonders die Filme von Rudolf Thome („Tagebuch“, „Fremde Stadt“) haben es mir angetan. Nicht, weil sie besondere Meilensteine des Kinos wären, sondern weil sie so viel von dem Lebensgefühl jener Jahre enthalten und bewahren. In all ihrer Unbeholfenheit und Naivität. Oder gerade deshalb. Wie quälend in „Tagebuch“ – mit gesuchtem Bezug auf Goethes „Wahlverwandtschaften“ – Beziehungen durchkonjugiert wurden, jaja, so schrecklich verkopft war das mitunter in den Siebzigern. Und wie Thome beispielsweise versucht hat, amerikanische Gangsterfilme nachzubilden… Mit heißem Bemüh’n, jedoch teilweise mit untauglichen Mitteln, mit unzulänglichen Darstellern. Und dennoch: Respekt! Das damals in diesem Lande so gewagt zu haben, ist ein bleibendes Verdienst.
…und natürlich Wenders, Herzog, Fassbinder
Sogar May Spils‘ „Zur Sache Schätzchen“ habe ich mir noch einmal angetan. Und tatsächlich: Die impulsive Rebellion, das Andersseinwollen ist auch in diesem Film gültig aufbewahrt. Auch Ulrich Schamonis „Alle Jahre wieder“ habe ich mir abermals angeschaut, in dem das altbekannte Spießertum der westfälischen Provinz (Münster) und seine noch zaghaften Gegenkräfte wieder aufleben. Kein Wunder, dass der Streifen alljährlich zur Weihnachtszeit am Hauptdrehplatz wieder und wieder gezeigt wird, wie andernorts nur „Das Leben des Brian“.
Auch Wim Wenders‘ „Alice in den Städten“ und Werner Herzogs „Stroszek“ zählen zum Umkreis der Filme, die mich zuletzt wie magisch angezogen haben. Und ich weiß schon, dass demnächst die üblichen Verdächtigen wieder an der Reihe sein werden: mehr von Wenders, Herzog und Fassbinder. Lieber noch wär’s einem auf der Kinoleinwand, doch zeigt mir bitte das Lichtspielhaus im Ruhrgebiet, in dem nennenswerte Arthouse-Retrospektiven laufen. Dabei wäre das Publikum der passenden Jahrgänge durchaus vorhanden.
_________________
P.S.: Der obige Screenshot kommt erst in Vergrößerung richtig zur Geltung. Ein Hinweis zu Vorgehen: https://www.revierpassagen.de/groessere-bilder