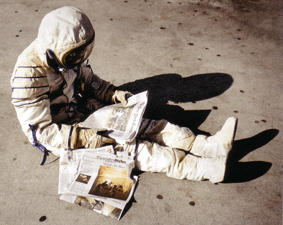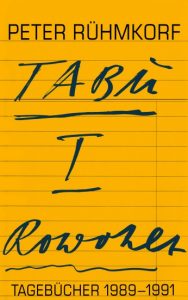30 Jahre „Dallas“: Als Larry Hagman der fiese J.R. wurde
Es war ein Dienstag vor 30 Jahren, zum ersten Mal gab’s „Dallas“. Genau genommen ist das schon einen Tag her, dieser Dienstag von 30 Jahren war ein 30. Juni, aber ich kann es nicht unterlassen, einige Worte darüber zu verlieren.
Der intellectuell correctness widersprach es ja zutiefst, sich dergleichen Flachsinn anzuschauen. Glatt, ultra-amerikanisch, superreich und mit seinen Protagonisten auch extrem fies – geht doch gar nicht!
Dennoch haben wir es zu Hauf geschaut. Wir staunten, was für Bösartigkeiten sich Larry Hagman als J.R. einfallen lassen konnte, wo er doch als der trottelig-liebenswerte Major Tony Nelson noch kurz zuvor die bezaubernde Jeannie bezaubert hatte, litten mit Sue Ellen, wenn sie sich dem Alkohol ergab, fieberten mit Bobby, wenn er um Pam warb oder seinem perfiden großen Bruder das ach so fiese Geschäft verderben wollte.
Da war sie, die Geburtsstunde der Telenovelas und ähnlicher Formate, und sie konnte doch mehr als diese neu benannten Altbekannten. Von unverhohlen bis heimlich starrte ein großer Teil des Fernseher-Deutschlands in diese dreiviertel Märchenstunde und verkniff sich in dieser Zeit jeden anderen Gedanken. „Dallas“ uniformierte seine Zuschauergemeinde, einte sie in einer bisher nicht gekannten Faszination (grenz- und schichtenübergreifend). Wenn der Vorspann begann und die legendäre Titelmelodie durchs Wohnzimmer trompetete, hatte jedes Gespräch zu ersterben, ungeteilte Aufmerksamkeit den Ewings und Barnes, obwohl die Geschichten dünn, die Charaktere glattgebügelt und die Botschaften mehr als ergänzungsbedürftig waren.
Gemeinsam mit den Mitarbeiter/innen der Buchhandlung, die unserer Redaktion gegenüber lag, gründeten wir eine „DDK“, Klartext: „Dallas-Diskussions-Kreis“. Nach einiger Zeit begannen wir mit begehrten, kurz gefassten Vorveröffentlichungen der nächsten Folge, deren Kenntnisse wir aus Holland importierten, die gingen mit den Staffeln etwas vor. Unser Redaktionsleiter mutmaßte, dass wir endgültig den Verstand verloren hatten. Angesichts des Echos, das diese Kurzmeldungen erfuhren, revidierte er seine Einschätzung allerdings sehr schnell.
„Dallas“-Dienstag bewahrte recht lange seine fesselnde Qualität. Bis sie nachließ, blieben wir ohne Verluste auf der Höhe von Zeit und Information. Der Kollege, der milde lächelnd und weise kopfschüttelnd unsere Aktivitäten verfolgte, drückte mehrfach sein völliges Unverständnis aus. Bis zum Tage, da er ungefragt und offenbar unkonzentriert die Handlung der Folge des Vorabends aufsagte, kurz verwundert war, weil seine Umgebung in hemmungsloses Gelächter ausbrach, und danach wieder die „Dallas“-Infizierten verhöhnte.
(Bild: Cover der DVD-Edition der kompletten ersten und zweiten Serienstaffel = 7 DVDs, Gesamtspieldauer 1350 Minuten, ca. 15 Euro)