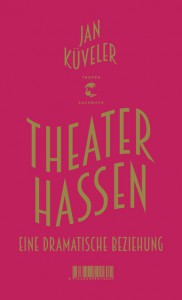Mit Selbstbezügen durchwebt: Frank Castorf ehrt Molière mit einem ausschweifenden Abend am Schauspiel Köln

Katharine Sehnert und Bruno Cathomas in Frank Castorfs „Molière“-Hommage am Schauspiel Köln. (Foto: Thomas Aurin)
Der schwere Mann hustet und droht sich zu übergeben. Heftig schüttelt ihn der Anfall. Die schwarzen langen Perückenhaare wirken verklebt, die Augen blutunterlaufen.
Ganz dicht hält die Kamera auf das Gesicht, zeigt den Schmerz, die Spuren des Verfalls. Es tut weh, wenn sich das Würgen laut, rauh und quälend lange aus der Kehle presst.
Frank Castorf erspart uns in seiner neuen Produktion am Schauspiel Köln nicht, dem tödlichen Martyrium des Mannes zuzusehen, dem er die fünfeinhalb Stunden im Depot 1 gewidmet hat: Jean-Baptiste Poquelin, später unter dem Namen Molière weltbekannt. Bruno Cathomas, eine Zeit lang im Ensemble Castorfs an der Volksbühne, spielt sich in diesem Moment existenziellen Grauens, aber auch der fesselnden Poesie die Seele aus dem Leib. Eine melodramatische Sterbeszene erspart Castorf sich und uns. Molière, in königlichem Hermelin mit blauem Samt, stürzt sich mit einem Beatmungsgerät in seinen alten Citroën-Kastenwagen und braust davon. Von seinem Tod wird nach Art der antiken Tragödie nur berichtet.
Castorfs Hommage gilt dem vor 400 Jahren am 14. oder 15. Januar geborenen Dramatiker, der die Komödie auf eine bis dahin kaum erreichte Höhe gehoben hat. Seine Stücke haben den Anspruch, in der Deutung der menschlichen Existenz mit der Tragödie gleichzuziehen. Es war nicht zu erwarten, dass Castorf ein Biopic auf die Bühne bringen würde – oder eine erzählende Handlung wie in Michail Bulgakows Molière-Schauspiel „Die Kabale der Scheinheiligen“, das Castorf 2016 an der Volksbühne selbst inszeniert hatte. Sondern er erfüllt die Erwartungen seiner Fans und entwirft ein riesiges Panorama von Molière-Texten, assoziativen Kommentaren, bildgewaltigen Auftritten, exzessivem Spiel. Und das alles immer wieder unterbrochen und verbunden durch die großartige Musikauswahl von William Minke.
Castorf provoziert spannungsvolle Langeweile, gelassene Dichte und atemlose Intensität. Er spielt mit Zitaten, Selbstzitaten, manchmal beiläufigen, manchmal ironischen Verweisen auf eigene Inszenierungen. Und das alles wäre nur halb so sinnlich reizvoll, gäbe es nicht die Kostüme von Adriana Braga Peretzki: showverliebt schillernde Stoffe, laszive Schnitte, betont sexuell konnotierte Weiblichkeit oder verunklartes Geschlecht. Dazu ein bisschen 17. Jahrhundert und viel, viel Erfindungsgabe.
Die Imagination ist unerschöpflich
So entsteht ein semiotischer Tsunami, gespeist aus der ausschweifenden, unerschöpflichen Einbildungskraft des Frank Castorf. Das Leben Molières selbst wird nur rudimentär thematisiert: Bei der Geburt des „bedeutenden Säuglings“ wirft sich Bruno Cathomas in voller königlicher Gewandung auf die Bühne, begleitet von einem greinenden Chor mit „Mutter“ Katharine Sehnert als Koryphäe. Der gelbe Kleinlaster spielt auf die wandernde Theatertruppe „L’illustre Théâtre“ an, das Molière mit der Schauspielerin Madeleine Béjart gegründet hatte. Davor reiht sich das Personal des Abends auf uns lässt sich erst einmal herunterputzen. Text nicht gelernt, Text vergessen, keine Textbücher: wiederkehrende Motive bei Castorf, lustvoll vorgeführt. Und Cathomas ereifert sich als Schauspieler-König mit unverkennbaren Anleihen an der Cholerik eines Theaterprinzipals. Unwillkürlich denkt man an Castorf selbst.

Zwischen lustvoller Gaukelei und poetischer Dichte: Das Ensemble des Schauspiels Köln bleibt fünfeinhalb Stunden in großer Form. (Foto: Thomas Aurin)
Der bestreitet den Hauptanteil des Abends mit Bruchstücken aus Molière-Komödien; der rote Faden in der Reihung und die Herkunft der Texte bleiben sein Geheimnis. „Der Bürger als Edelmann“ taucht auf, auch „Die gelehrten Frauen“. Andere Bausteine könnten aus „Der Geizige“ stammen. Und klingen nicht auch „Die lächerlichen Preziösen“ und „Der eingebildete Kranke“ an, nach dessen vierter Vorstellung der historische Molière, noch im Kostüm der Hauptrolle, gestorben ist?
Zitiert – nein, eindrücklich gelesen – wird auch Michail Bulgakow, so der demütigende Brief an Stalin, in dem er zuerst um eine Regieassistenz bittet und am Ende der „Sowjetmacht“ alle Verfügungsgewalt über sich einräumt. Ein von Jeanne Balibar und Justus Maier beklemmend vorgetragenes Zeitdokument. Sein Verweischarakter ist deutlich: Wie Molière vom „Sonnenkönig“ abhängig war, der ihn vor Angriffen aus Teilen des katholischen Klerus schützte, war auch Bulgakow der unberechenbaren Gunst des Sowjetdiktators ausgeliefert.
Virtuos bespieltes Panorama
So virtuos wie stets die Bühne von Aleksandar Denic – Ausstatter u.a. von Castorfs Bayreuther „Ring“ – in ihrer Breite auch bespielt wird: In den Monologen der Schauspieler, in Momenten konzentrierter Intimität schafft es Castorf nicht zuletzt dank der Lichteinfälle von Lothar Baumgarte, den Raum genau auf die Szene zuzuschneiden. Auch Denic zitiert: Den Thespiskarren mit einem kleinen Kulissentheater gab es schon in Castorfs Münchner „Don Juan“ (2018), die Zimmerchen, die sich hinter der monumentalen Fotowand mit vier zeitungslesenden Pariser Bürgern des 19. Jahrhunderts verstecken, erinnern an den „Baal“ von 2013. In einem davon spielt sich ein „Klassiker“ der Castorfschen Formensprache ab: eine Badeszene in einem raumfüllenden Zuber, mitsamt den nackten Leibern der Darsteller nur im Live-Video einsehbar und Schauplatz einer aufgedrehten Kunstdebatte, in der dann sogar der Primat der Fechtkunst eingefordert wird. Später sollte in einer halb drögen, halb komischen Molière-Szene das Ausformen der Vokale studiert werden.

Im Zentrum des Ensembles: Jeanne Balibar, hier mit Paul Basonga. (Foto: Thomas Aurin)
„Molière“ ist – mit Gast Jeanne Balibar als unverkennbares Kraftzentrum – ein Abend des Kölner Ensembles. Eine Reihe junger Darsteller, die sich immer lockerer freispielen, im Sprechen, Schreien, Deklamieren mit den Worten Emotionen hinausschleudern, mit ihren kratzenden Kehlen genauso rotzig wie die Szene, auf die ein „Arc de Triomphe“ als „Arsch mit Ohren“ gerollt wird. Und immer authentisch, sogar große Sprech-Kunst streifend: Alexander Angeletti und Paul Basonga, Justus Maier in Slip und weißen Strümpfen in großartigem Monolog, Lola Klamroth als hoch gewachsenes, blondes Pendant zu Balibar. Das junge Ensemblemitglied Kei Muramato aus Japan, zwischen Geschlechtern changierend, hat einen großen Auftritt, wenn er sich in den Butoh-Tanz versenkt und minutenlang japanisch rezitiert, während alte US-Filme über die Wirkung eines Atombombenabwurfs laufen. Das sind dann die Momente, in denen Castorf seine Assoziationsketten allzu arg strapaziert.
Ein Dämon, als Mensch verkleidet
Am Ende wird berichtet, warum das Grab des „Königs der dramatischen Kunst Frankreichs“ unauffindbar verschwunden ist, während Marek Harloff welke Blätter zusammenkehrt: Ein melancholisches Bild der Vergänglichkeit, das gleich wieder ironisch-vielsagend konterkariert wird, wenn das Ensemble als buntschillernde Schlange über die Bühne kriecht, ein Gaudiwurm oder ein chinesischer Drache. „Ich bin ein Dämon, Fleisch geworden und als Mensch verkleidet“ betitelt Castorf seinen Molière-Abend. Es ist ein in die Ich-Form gebrachtes Zitat aus einer zeitgenössischen Quelle über Molière, mit dem ihn seine kirchlichen Gegner verdammt haben.
Dabei haben sie übersehen, dass sich der als „pietätloser Libertin“ verschriene Molière mit seinem wohl berühmtesten Stück, dem „Tartuffe“, nicht gegen Glauben, Kirche oder Moral gewandt hatte, sondern gegen ihren Missbrauch durch Machtgier, falsche Frömmigkeit, religiöse Heuchelei und Gewalt im Gewand vermeintlicher Wohltat. Castorf könnte – das ist problemlos anzunehmen – den „Dämon“ genauso auf sich selbst beziehen wie auf den großen Franzosen. Denn mit seinem Kölner Abend hat er nicht allein Molière ein Denkmal gesetzt, sondern auch sich selber und seiner mit Selbstbezügen durchwebten Kunst.
Weitere Vorstellungen: 28. Januar, 4., 6., Februar, 5. März. Info: https://www.schauspiel.koeln/spielplan/a-z/moliere/