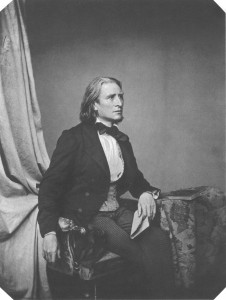Klavier-Festival Ruhr: Mit Bravour in die Sommerpause
Zum Ende der Sommer-Ausgabe des Klavier-Festivals Ruhr 2021 spielten Arcadi Volodos und Lise de la Salle herausragende und emotional bewegende Konzerte. Gastautor Robert Unger berichtet.
Bereits zum 17. Mal war Arcadi Volodos zu Gast beim Klavier-Festival Ruhr und interpretierte in Herne zu Beginn seines Konzertes die sechs Klavierstücke op. 118 von Johannes Brahms. In diesen gewichtigen Miniaturen zeigt Volodos seine Genialität in einer unaufgeregten, fein ausgeformten und präzisen Spielweise. Auch seine dynamische Finesse entfaltet sich im elegant flanierenden ersten „Intermezzo“. Jeder Ton findet Raum zur Klangentfaltung, die Bass-Linie wird hervorragend ausgeformt.
Im zweiten Teil des Konzertes kann der Pianist seine exzellenten Fähigkeiten in der Interpretation der Sonate A-Dur D 959 von Franz Schubert abermals unter Beweis stellen. Die Sonate, die zu den letzten drei Klaviersonaten des Komponisten gehört und als „klangschönste“ und „pianistischste“ bezeichnet wird, ist eine perfekte Partnerin für Volodos. Schon der Beginn mit seinen dominanten Oktaven in der linken Hand und der fast barocken Rhythmik zeigt ausgesprochen kraftvolles, an Beethoven gemahnendes Profil. Die dritte Wiederholung des Auftaktmotives kleidet Volodos in stilvoll zurückgenommene Virtuosität.
Höhepunkt des Konzertes ist dann ohne Zweifel das Andantino der Sonate. Der düster-fatalistische Charakter des Satzes mit den abrupten Einschlägen wirkt in seiner romantischen Zerrissenheit aus seiner Zeit hinaus weisend. Mit klaren Linien und Feingefühl interpretiert Volodos die Sonate bis zum letzten Ton. Das Publikum erhebt sich zu einem lang anhaltenden Applaus; der Pianist dankt für die Anerkennung mit fünf sehr unterschiedlichen und eindrücklichen Zugaben von Schubert, Brahms, zwei Mal Frederic Mompou und Alexander Skrjabin.
Gedenken an Flutopfer
Dem Intendanten des Festivals, Franz Xaver Ohnesorg, war es ein Anliegen, das Abschlusskonzert am 16. Juli mit Lise de la Salle in der Mercatorhalle in Duisburg nicht ohne Gedenken an die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beginnen zu lassen. Ohnesorg nutzte seine sonst routinemäßige Begrüßung, mit bewegenden Worten den Geschädigten sein Mitgefühl auszusprechen. Lise de la Salle hatte sich entschlossen, ihrem Konzertprogramm Johanns Sebastian Bachs Choral „Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“ in der Bearbeitung Ferruccio Busonis voranzustellen. Danach erhob sich das Publikum zum Gedenken still von seinen Plätzen. Solche Momente kann es nur in Live-Konzerten geben; kein Streaming-Angebot vermag einen solchen Akt gemeinsamer Sammlung und bewegend ausgedrückten Mitgefühls hervorzurufen.
Viel mehr als eine „Einspringerin“
Lise de la Salle, die seit ihrem Debüt 2012 erst zum dritten Mal beim Klavier-Festival Ruhr auftritt, beweist, weit mehr als ein „Ersatz“ für die in den USA auf ihre Visa-Unterlagen wartende Hélène Grimaud zu sein. Viel mehr als bloß eine Einspringerin, überzeugt sie mit einer völlig unprätentiösen, jeglicher Virtuosen-Zelebration abholden, geradezu spirituellen Interpretation der herausfordernden h-Moll-Sonate von Franz Liszt. Den Rahmen setzen spanische und lateinamerikanische Tänze und Charakterstücke von Isaac Albéniz und Alberto Ginastera: Die „Cantos de España“ mit dem als Gitarrenstück berühmt gewordenen „Asturias“ und Ginasteras „Tres Danzas Argentinas“ spielt Lise de la Salle bewundernswert präzis, kristallklar in den an Gitarrentechnik erinnernden Akkordsalven, rhythmisch schmiegsam und mit einer faszinierenden Palette von Anschlagsfarben. Dieser Pianistin möchte man gerne wieder begegnen.
Ausblick auf den Herbst
In einem Video zur ersten Halbzeit des Klavier-Festivals auf dessen Webseite zeigt sich Franz Xaver Ohnesorg dankbar für die großzügige Unterstützung der Sponsoren sowie die Treue und den Zuspruch des Publikums. Mit einer Auslastung von 80 Prozent unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Hygieneregeln kann der Intendant ohne Frage zufrieden sein. Dennoch kommt die Frage auf, warum es nicht gelungen ist, mehr Konzertbesucher zu aktivieren? Ist der meist kurzfristige Vorverkauf schuld? Empfinden die Menschen die Hygieneregeln als zu einschränkend? Fehlt ein unbeschwertes Gemeinschaftserlebnis? Oder befürchten die früheren Konzertbesucher angesichts der Meldungen über eine sich anbahnende vierte Welle gesundheitliche Risiken? Dazu wird es noch einiger sorgfältiger Analysen bedürfen.
Ohnesorg jedenfalls schaut mit professioneller Zuversicht auf die am 3. September startende Herbstausgabe des Klavier-Festivals. Er hat es wieder geschafft, ein umfangreiches, hochkarätiges, aber auch mit 15 Debüts besetztes Programm zusammenzustellen. Für das Festival, das normalerweise von Mai bis Juli seine Spielzeit hat, wird es wohl dennoch nicht einfach, sich gegen die Fülle von Premieren und Eröffnungskonzerten durchzusetzen, die im September alle gleichzeitig um das musikliebende Publikum buhlen werden.
Zum Auftaktwochenende vom 3. bis 5. September erwartet das Publikum drei exquisit besetzte Konzerte: mit den Brüdern Lucas und Arthur Jussen in Mülheim/Ruhr, mit Anne-Sophie Mutter, Lambert Orkis (Klavier) und Pablo Ferrández (Cello) in Essen und ein Abend, bei dem Sir András Schiff in der Philharmonie Essen ein erst zu Konzertbeginn verkündetes Überraschungsprogramm spielt. 35 Konzerte sollen bis Dezember 2021 wieder im gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus das Publikum in seinen Bann ziehen.

Er wird anlässlich seines 90. Geburtstags durch eine Reihe von Konzerten geehrt: Alfred Brendel, geschätzter Mentor vieler heute weltberühmter Pianisten. Foto: KFR/Mark Wohlrab
Weitere Höhepunkte sind sicherlich die Konzerte anlässlich des 90. Geburtstages von Alfred Brendel mit Pianisten, denen Brendel als Mentor verbunden ist – so Pierre-Laurent Aimard, Kit Armstrong, Imogen Cooper, Francesco Piemontesi und Anne Queffélec. Wieder dabei sind Meisterpianisten wie Marc-André Hamelin, Krystian Zimerman und Jos van Immerseel. Unter den fünfzehn Debütanten finden sich junge Talente wie die von Evgeny Kissin benannte Stipendiatin des Klavier-Festivals Ruhr 2020, Eva Gevorgyan, den Gewinner des Brüsseler Wettbewerbs „Reine Elisabeth“ 2021, Jonathan Fournel oder die Schülerin des legendären Dmitri Bashkirov, Pallavi Mahidhara. In der Jazz-Line kommt endlich der Stipendiat des Jahres 2020, der chinesische Jazz-Pianist, A Bu, zu seinem pandemiebedingt verspäteten Debüt.
Ab sofort können sich Interessierte auf www.klavierfestival.de Ihr Vorkaufsrecht für zahlreiche Konzerte sichern. Der eigentliche Ticketverkauf beginnt am Donnerstag, 19. August.