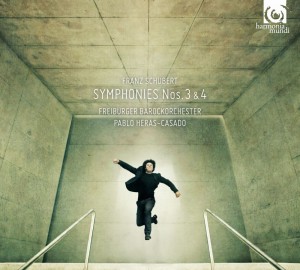Fein abgestuftes Kolorit: Frank Peter Zimmermann und die Essener Philharmoniker mit Frank Martin und Franz Schubert

Andrea Sanguineti und die Essener Philharmoniker. Foto: Volker Wiciok
Die Musik von Frank Martin braucht einen Fürsprecher wie Frank Peter Zimmermann, denn der Schweizer Komponist hängt merkwürdig zwischen Zeiten und Stilen fest. Das ist exemplarisch an seinem Violinkonzert abzulesen, das in der Essener Philharmonie mit dem aus dem benachbarten Duisburg stammenden Geiger eine erstklassige und vom Publikum warmherzig applaudierte Aufführung erlebte.
Martins breit gefächertes Schaffen findet im Betrieb sonst wenig Aufmerksamkeit. Den einen ist es zu unentschieden unneuzeitlich, den anderen ist diese Musik einer vergangenen Generation immer noch zu „modern“. Martins feinsinniger Konservatismus der Form – ein klassisch dreisätziges, halbstündiges Solo-Konzert – ist jedoch von so souveräner, mit Gewinn hörbarer Musik erfüllt, dass man getrost die Suche nach dem Fortschritt einstellen kann. Hier wirkt nichts erzwungen oder krampfhaft auf dem Stand seiner Zeit. Von der Stiftung Pro Helvetia beauftragt und dem verdienstvollen Musik-Anreger Paul Sacher 1952 uraufgeführt, ist das lyrisch grundierte Konzert jenseits seines Eigenwerts ein Hinweis, dass die Musik der Nachkriegszeit vielleicht doch nicht so vernachlässigt werden sollte, wie es manche (spät)romantiksüchtigen Programme leider praktizieren. Zimmermann wird das Konzert 2026 in fünfzehn Konzerten in ganz Europa spielen, u.a. in Stockholm, Amsterdam, München, Paris und Wien.

Frank Peter Zimmermann trat zum ersten Mal vor 45 Jahren mit den Essener Philharmonikern auf. Nun kehrte er mit Frank Martins Violinkonzert zurück. Foto: Irène Zandel
Frank Martin leistet sich eine Tugend, die Komponisten heute im Reich der unbegrenzten Möglichkeiten gerne vergessen: kein orchestraler Aufwand, sparsame Bläserbesetzung, dazu nur eine Harfe, ein Klavier, weiter nichts. Die luftig-leichte Einleitung erinnert an Franz Schubert und Martins unmittelbar vorher entstandenen „Cinq chansons d’Ariel“ – und führt sogar zu seiner Oper nach Shakespeares „Der Sturm“ von 1956. Aus diesem Morgendämmern von Violinen und Solo-Flöte öffnet sich Zimmermanns wundervolle Stradivari wie eine Blüte mit zarten Blättern in sanft leuchtender Farbe. Es gibt keine markante Themen-Einführung, kein „Hier bin ich, hört mir zu!“. Kein Stoff für Virtuosen, umso mehr Vorlage für Musiker.
Feine Nuancen – strahlende Präsenz
Doch die drei Sätze: Allegro tranquillo, Andante molto moderato, Presto – leider fehlen die Angaben im Programmheft – geben Zimmermann noch reichlich Gelegenheit, rund gesättigten Ton, erhabene Phrasierung, markanten Zugriff und sogar einen Hauch musikantischen Übermuts zu zeigen. Am schönsten fließen die fein nuancierten Töne der meditativen Momente, etwa der geheimnisvoll schimmernde Schluss des ersten Teils. Die Steigerungen hin zur strahlenden Präsenz der A- und E-Saiten, der kräftige Bogenstrich, die rhythmische Geistesgegenwart sind hinreißend; die Balance mit den niemals drängelnden oder Dominanz ausstellenden Essener Philharmonikern lassen Martins Konzert weniger als Wettstreit, denn als glückhaftes Übereinstimmen erleben.
Wir bleiben in eher lyrischen Gefilden: Nach der Pause nehmen sich Dirigent Andrea Sanguineti und die Philharmoniker Franz Schuberts „große“ C-Dur-Sinfonie (D 944) vor. Auch hier gelingt nach dem naturhaft entspannten Hornruf von draußen der Beginn in den Streichern locker und duftig, steigert sich dann mit Bruckner-Aplomb im Blech zum ersten Fortissimo-Höhepunkt, zeigt heftige Akzente, die zum Glück keine „Schwammerl“-Weichheit reproduzieren. Sanguineti beschwört das Orchester, holt aus, als schwänge er einen Golfschläger, zeigt den Streichern die Fäuste, befiehlt den Bläsern mit imperialer Geste, dämpft dann beinahe zerknirscht die Lautstärke ab. Schubert verträgt`s. Die lockeren Geigen, das präsente Holz, das strahlende Bläserglück im Finale bleiben stets diszipliniert: Lautstärke wird nie zum Lärm.
Melodische Empfindung – pulsierender Rhythmus
Den Marsch des zweiten Satzes, Andante con moto, nimmt Sanguineti weniger traurig-melancholisch als markig-bestimmt, belässt ihm aber das von Robert Schumann gepriesene „Kolorit bis in die feinste Abstufung“. Oboe und Klarinette tun sich hervor, die Celli haben nach der Generalpause einen Moment reinsten Wunders. Im Allegro-vivace-Scherzo lässt Sanguineti los, öffnet dem Orchester Freiraum, die überreiche melodische Erfindung auszukosten. Und im letzten Satz gibt er dem pulsierenden Rhythmus die nötige Steigerung ins Monumentale, ohne die Schubert’sche Poesie einem Beethoven-Ingrimm zu opfern. Dennoch: Man hört, nicht zuletzt im Abbruch, wo Bruckner und selbst Mahler anknüpfen.
Dass am Ende eine Stunde verflossen ist, mag man nicht glauben: Schuberts unwiderstehlicher Fluss musikalischer Ideen hat – wie es Joachim Kaiser einst ausdrückte – der „Diktatur des Uhrzeigers“ erfolgreich widerstanden. Herzlicher Beifall für die Essener Philharmoniker, Jubel für Frank Peter Zimmermann, zumal nach seiner Zugabe, der „Grand Caprice“ op. 26 des Brünner Stargeigers Heinrich Wilhelm Ernst (1814-1865) nach Schuberts Ballade „Der Erlkönig“ – harsche Klänge von gespenstischer Expressivität.
Das nächste Sinfoniekonzert der Essener Philharmoniker in der Philharmonie leitet am 12. und 13. Februar 2026 die estnische Dirigentin Kristiina Poska, bis 2025 Chefdirigentin des Symfonieorkest Vlaanderen in Gent. Auf dem Programm: Béla Bartóks Rumänische Volkstänze, Reinhold Glières B-Dur-Konzert für Horn und Orchester op. 91 mit Radek Baborák als Solist und Piotr Tschaikowskys Vierte Sinfonie. Karten: (0201) 81 22 200, www.theater-essen.de