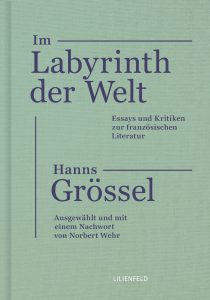Der schnelle Übergang vom Guten zum Bösen: Emmanuel Boves Kurzroman „Schuld“ und neun Erzählungen
Als der kurze Roman Schuld von Emmanuel Bove 2010 erstmals auf Deutsch erschien, war das Buch schnell vergriffen. Nun, acht Jahre später, veröffentlicht der Lilienfeld Verlag unter dem Titel Schuld und Gewissensbiss eine um neun Erzählungen erweiterte Ausgabe. Etwa die Hälfte des schönen Bands aus der Reihe der Lilienfeldiana nimmt der Roman Schuld ein.
Der Originaltitel Un Raskolnikoff, unter dem das Werk zuerst im Dezember 1931 in Frankreich erschienen ist, zeigt noch deutlicher als der deutsche Titel die Verbindung zum großen russischen Roman Schuld und Sühne.
Im Unterschied zu Dostojewskis Romanfigur Raskolnikow, der sich zum Mord berechtigt glaubt, geht es jedoch in Emmanuel Boves kürzerer Replik um eine allein vom Protagonisten Changarnier gefühlte, wenn nicht gar herbeigesehnte Schuld, für die der Lesende keinen Anlass erkennt. Er hat niemanden ermordet, auch nicht den etwa fünfzigjährigen kleinen Mann, der ihm und seiner Freundin bei ihrem Streunen durch die winterliche Stadt nicht von der Seite weicht.
Gleichwohl wird der verhaltensauffällige Changarnier von der Polizei festgenommen und auf der Wache verhört. Der – wie mehrere Antihelden bei Bove – gedanklich stets angespannte Selbstquäler ruft während der Vernehmung in einer grotesk theatralischen Geste den Allmächtigen als Zeugen herbei und hört, gleichsam als ein ihn enttäuschender Deus ex Machina, eine Stimme, die ihn auf die erste Lossagung des Menschen von Gott, den Sündenfall, verweist: Indem der Mensch alles wissen wollte, habe er sich von Gott getrennt und werde bis zu seinem letzten Tage allein bleiben. Der nach einer Gegenüberstellung mit einer Zeugin wieder auf freien Fuß gesetzte Changarnier dürfte auch in der Fortsetzung seines Weges nicht von Grübeleien erlöst sein.
Unvermuteter Grund für den Gewissensbiss
Haben wir es in Schuld mit einem grundlos erscheinenden schlechten Gewissen zu tun, gäbe es in der kurzen Erzählung Der Gewissensbiss mehr als nur einen Grund. Nach einem beachtlichen sozialen Aufstieg neigt Doktor Jacques Figue dazu, gegenüber der angeheirateten Familie sein Elternhaus zu verleugnen. Lediglich die monatliche Geldüberweisung dient dazu, sein Gewissen zu besänftigen. Während eines Urlaubs in Südfrankreich bittet er seine Frau um Verständnis, dass er nach sieben Jahren völliger Kontaktlosigkeit seine in der Nähe auf dem Land lebenden Eltern kurz besuchen möchte.
Die Ehefrau aus gutsituiertem Hause aber denkt nur daran, dass sie ungern zwei Stunden an einem kleinen Provinzbahnhof auf ihn warten möchte. Mit dem Versprechen, nicht lange fortzubleiben, läuft Doktor Figue in sein Heimatdorf. Die alte Mutter ist überglücklich, den Sohn noch einmal zu sehen. Der Vater jedoch sei an dem Tag nach Marseille gefahren. Doktor Jacques Figue will die Rückkehr des Vaters nicht abwarten. Um seine Frau nicht zu lang alleinzulassen, verabschiedet er sich bereits nach einer Stunde von der weinenden Mutter. Als er mit seiner Frau im Bahnhofscafé auf den Zug nach Marseille wartet, sieht er plötzlich, wie sich die gebeugte Mutter dem Bahnhofsvorplatz nähert. Um seiner Frau die Begegnung zu ersparen, entscheidet er kurz entschlossen, mit ihr im Taxi zurück nach Marseille zu fahren. Im letzten Absatz wechselt die Perspektive, und der titelgebende Gewissensbiss stellt sich als ein völlig anderer heraus, als die vorangegangen sechs Seiten vermuten ließen.
Ereignisse und Charaktere immer wieder neu bewerten
In Gotthold Ephraim Lessings Faust-Fragment dienen sich dem Geisterbeschwörer verschiedene Teufel an, die sich allesamt in behaupteter Schnelligkeit zu übertrumpfen versuchen. Faust entscheidet sich für den, der für sich beansprucht, so schnell „als der Übergang vom Guten zum Bösen“ zu sein. Etwas von jenem Teufel muss wohl auch in den kurzen Erzählungen Emmanuel Boves stecken.
Der Lesende ist manchmal gefordert, die Ereignisse und Charaktere auf fast jeder Seite neu zu bewerten. Die Protagonisten geraten immer wieder in moralische Zwickmühlen. Wie bei dem Mann, der nach dem Tod eines nahen Freundes bei der Witwe dessen Schulden eintreibt – was zu weiteren Verwicklungen führt („Die dreitausend Francs“). Man könnte sagen, die Sympathiesteuerung des Autors hinsichtlich seiner Figuren vollführe scharfe Wenden, gelänge es ihm nicht, auch für diejenigen, die in ihrem kleinbürgerlichen Ordnungssinn gefangen und zur Rechthaberei verdammt erscheinen, Verständnis zu wecken.
Großzügiger Förderer gerät ins soziale Abseits
Ein weiteres gutes Beispiel ist die acht Seiten umfassende Erzählung Das Testament. Ein angesehener Geschäftsmann aus Cherbourg fördert einen jüngeren, an seinen Wohnort Zugezogenen, mit allen Mitteln, gliedert ihn fast schon in seine Familie ein und verschafft ihm die für ein erfolgreiches Geschäftsleben nötigen Kontakte. Aufgrund einer bald nicht mehr nachvollziehbaren Kleinigkeit geraten beide in einen sich eskalierenden Streit. Da aber hat sich der Jüngere innerhalb der städtischen Gesellschaft bereits so viel Sympathie erworben, dass nun der einstige Förderer durch seinen sich steigernden Hass ins soziale Abseits gerät. Er vereinsamt, erkrankt und stirbt. Die Gerüchte über den Inhalt seines Testaments und die Reaktionen der Stadtgesellschaft beleuchten das Geschehen von einer anderen – von einer patriotischen – Seite, ohne den Eindruck des Zwielichtigen auszuräumen.
Die letzten Lebensjahre des Schriftstellers

„Er wünschte, auf dem Friedhof Montparnasse beerdigt zu werden, und hatte schon im Voraus ein dreißigjähriges Nutzungsrecht an einer einfachen Grabstätte erworben, die zufällig ein paar Meter von Emmanuel Boves Grab entfernt lag.“ – Michel Houellebecq über seinen gleichnamigen Protagonisten im Roman Karte und Gebiet (La carte et le territoire).
Foto: Wolfgang Cziesla
Das Testament ist eine von vier Erzählungen, die Bove im Spätsommer 1944 unter einem Pseudonym in der algerischen Wochenzeitung La Marseillaise veröffentlichte. Bove, der es ablehnte, im von deutschen Truppen besetzten Frankreich zu publizieren, lebte von November 1942 bis Oktober 1944 in einer Vorstadt von Algier. Seine politischen Hoffnungen setzte er auf General de Gaulle; das voraussehbare Kriegsende klingt in den Erzählungen an.
Welche Rolle Bove sich selbst im Nachkriegsfrankreich zudachte, kann nur vermutet werden. Er starb im Alter von nur 47 Jahren zwei Monate nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Sein Grab befindet sich in der Familiengruft seiner zweiten Ehefrau, Louise Ottensooser, auf dem Friedhof Montparnasse, in der Nähe der Cafés von Saint-Germain-des-Prés, in denen er mehrere seiner einzigartigen Romane schrieb.
Emmanuel Bove: Schuld und Gewissensbiss. Ein Roman und neun Erzählungen. Aus dem Französischen übersetzt und mit einem Nachwort versehen von Thomas Laux. Lilienfeld Verlag, Düsseldorf, Reihe Lilienfeldiana, Band 24. 176 Seiten, Halbleinen, Fadenheftung, Leseband, € 20