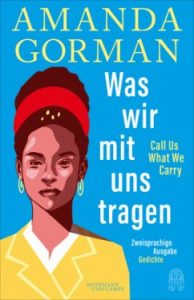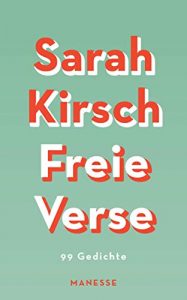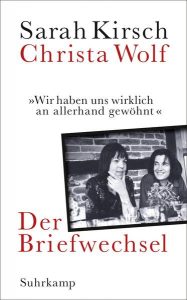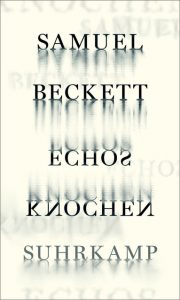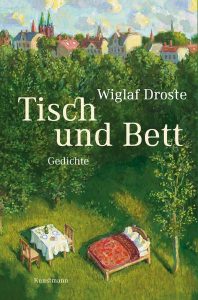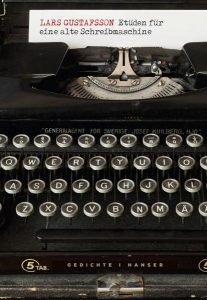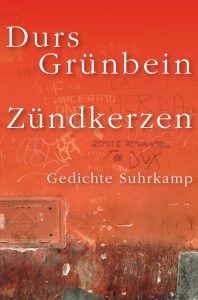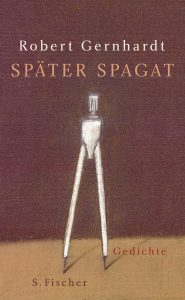Heimkehr von den Irrfahrten – Christoph Ransmayr und Anselm Kiefer schufen ein Buch, das überdauern wird
Odysseus ist müde und ausgelaugt, viel zu lange war er unterwegs, hat unzählige blutige Schlachten geschlagen, sich auf der Suche nach der verlorenen Heimat heillos verzettelt und ist durch das Labyrinth der Menschheitsgeschichte geirrt. Die sich um ihn und seine endlose Reise rankenden Mythen und Märchen sind ihm nur noch schnuppe und können seine Sehnsucht nicht mehr stillen.
Ausgezehrt liegt der listenreiche Städteverwüster in irgendeinem Krankenhaus, lässt seine Blutwerte noch einmal checken, wartet auf seine Entlassungspapiere und seinen Pass, sieht bereits das Meer wieder vor sich „und auf seinem Spiegel / ein gleißendes Gespinst möglicher Routen, / ein Knäuel von Routen der Heimkehr, / die am Ende vielleicht / alle zurückführen / in die Ruinen von Troja.“
Mit einem durch Zeit und Raum, Realität und Utopie irrlichternden „Odysseus“ eröffnet Christoph Ransmayr seinen neuen Band mit Gedichten und Balladen, in dem Schönheit und Schrecken, Poesie und Politik, Dichtung und Malerei sich vermählen und zu einem göttlichen Kunstwerk vereinen. „Unter einem Zuckerhimmel“ lautet der fast idyllische Titel dieses schillernden Crossover-Projekts, zu dem der renommierte Künstler Anselm Kiefer zahllose Aquarelle beigesteuert hat.
Mit Tusche, Bleistift und Kohle hat Kiefer, dessen Werk schon oft um blutige Abgründe, verdrängte Kriege und vergessene Mythen kreiste, seine Farb-Fantasien den poetischen Visionen gegenübergestellt. Was Kiefer auf Gips und Karton getupft und gespritzt hat, bebildert und kommentiert nicht die Balladen und Gedichte, sondern spricht eine eigene künstlerische Sprache, lässt mal eisig blaue, mal blutig rote Farbe auf einen Malgrund tropfen, zieht schwarze Linien und kindlich gekritzelte Buchstaben durch die erdig und steinig wirkende Landschaft.
Christoph Ransmayr lebte Jahrzehnte aus dem Koffer, machte das Unterwegs-Sein zur Lebens-Philosophie, war stets auf der Suche nach einem überraschenden Gedanken und schönen Gedicht, durchquerte Wüsten, stieg auf hohe Berge und reiste zum Nordpol, war immer ein Reisender und Suchender, der „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“ und „Die letzte Welt“ besang, „Eine kurze Geschichte vom Töten“ und den „Atlas eines ängstlichen Mannes“ beschwor.
Jetzt scheint Ransmayr zur Ruhe gekommen und lebt wieder in Wien. Doch umso dringlicher erinnert er an den ruhelos durch die Geschichte irrenden „Odysseus“, sendet uns „Nachrichten aus der Höhe“ und erzählt vom „Trost des Steinschleifers“, der sich oft stundenlang verliert in den Tiefen kristalliner Strukturen und in ihnen „ein geheimnisvolles, laut- und zeitloses Bild der Welt“ sieht, „das ihn alle Sensationen und Schrecken / der Geschichte des organischen Lebens / vergessen lässt / und ihm verspricht: / Etwas von dieser Arbeit / wird überdauern. / Nicht für immer, aber länger, / viel länger als alles, / was welken, faulen / und schmerzen kann.“
Der Dichter als Steinschleifer: Auch die Balladen und Gedichte des heimatlos durch Gedankenwelten reisenden Poeten werden überdauern, noch lange weiter leben und uns den Weg dahin zeigen, wohin wir doch alle immer wieder zurück kehren wollen: nach Hause. In der „Ballade von der glücklichen Rückkehr“ ist der ziellos um den Globus reisende Dichter das Unterwegssein leid:
„Genug! Genug. Eines Tages ist es genug. // So weit sind wir gegangen, / so hoch sind wir hinaufgestiegen, immer höher, / bis uns der nächste Schritt ins Blaue geführt hätte, / in die Wolken, nur noch ins Leere“. Erduldet hat er „Orkan. Hunger. Wunden. / Höhenwahn. Fieber. Angst. / Die Erschöpfung oder das Heimweh.“
Doch jetzt reicht es: „Eines Tages kehren wir unseren Träumen / den Rücken / und machen uns auf den Weg in die Tiefe, / zurück zu den Menschen“, wollen nur noch „nichts wie weg. / Wir wollen nach Hause!“ Doch das Zuhause muss kein Ort, kann auch eine Erinnerung sein: an die „Buchstabensuppe, deren Lettern auf dem Tellerrand von meiner Mutter zu Zeilen angeordnet wurden“, den Gedanken, dass „Verse und gesungene Strophen die vollendete Form einer Geschichte“ sein und Balladen den Krieg besingen, aber nicht bannen können:
„Wir spielen / unter einem Zuckerhimmel / Krieg, // nennen flackernde / Strohfeuer / Ewigkeit // und jede Katastrophe / einen Sieg. // Was immer auf uns niederfährt: / Wir nehmen es gelassen, / heiter // und spielen / und spielen weiter / unter einem Zuckerhimmel Krieg.“
Dass Autor und Maler sich lange schon kennen und schätzen, Ransmayr dem Freund ein literarisches Denkmal setzte („Der Ungeborene oder Die Himmelsareale des Anselm Kiefer“), der sich jetzt sich mit zeitlos-schönen Bildern revanchierte, darf man getrost einen Glücksfall nennen. Ein Prachtband zum Verweilen und Träumen, ein Buch, das man immer wieder neu lesen und anders betrachten kann. Ein Buch, das überdauern wird.
Christoph Ransmayr: „Unter einem Zuckerhimmel. Balladen und Gedichte“, illustriert von Anselm Kiefer. S. Fischer Verlag, 208 S., 58 Euro.
__________________________
Infos:
Christoph Ransmayr, geboren 1954, lebt nach Jahren in Irland und auf Reisen wieder in Wien. Für seine Romane „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“, „Die Letzte Welt“, „Morbus Kitahara“, „Der fliegende Berg“, „Cox oder Der Lauf der Zeit“, „Der Fallmeister. Eine kurze Geschichte vom Töten“ und „Atlas eines ängstlichen Mannes“ erhielt der Autor zahlreiche, auch internationale Auszeichnungen. „Unter einem Zuckerhimmel“ ist der zwölfte Band seiner Buch-Reihe „Spielformen des Erzählens“. (FD)
Anselm Kiefer, geboren 1945, zählt zu den bedeutendsten und innovativsten Künstlern der Gegenwart. Mit Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Film und Installation versucht er immer wieder, sich der jüngeren deutschen Geschichte zu stellen, das „Nichtdarstellbare“ zu erfassen und Motive und Themen aus Philosophie und Literatur, Wissenschaft und Religion in Bilder zu verwandeln. 2008 erhielt er (als erster bildender Künstler) den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. (FD)