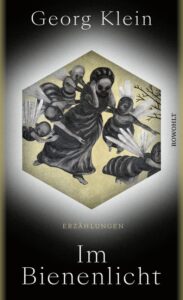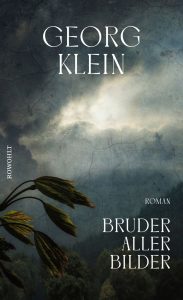Unterwegs ins Unerklärliche: Georg Kleins Erzählungsband „Im Bienenlicht“
Zum seinem 70. Geburtstag (29. März) legt uns Georg Klein einen neuen Band mit Erzählungen vor. Im Bienenlicht heißt die Zusammenstellung von achtzehn Texten, gegliedert in zwei Teile, die mit „Wachs“ und „Honig“ überschrieben sind.
In bester Tradition des phantastischen Erzählens lotet Georg Klein die Grenzen dessen aus, was mit Literatur möglich ist, und scheint sich in manchen der Texte noch einige verwegene Schritte tiefer ins Neuland vorzuwagen als in seinen bisherigen Romanen und Erzählungen.
Sich treu geblieben ist der Autor in seiner Vorliebe für das Skurrile, für das Traumhafte und Phantastische, in seinem Hang zu kunstvollen Verrätselungen, im Schaffen dichter, oft unheimlicher Atmosphären. Aus früheren Romanen und Erzählungen bekannte Themen und Motive tauchen auch in dieser Sammlung auf, zum Beispiel das Technische, die Apparate und die Symbiosen, die der Mensch mit ihnen eingeht. Technische Geräte werden gepflegt, liebevoll gewartet wie Wesen mit einer Seele. „In der Werkstatt hievten wir den gründlich geputzten Blasator vom Tisch. ‚Jetzt mach du. Dich ist er gewohnt.‘“
Vom Vertrauten ins Unerklärliche
Doch auch im Text Arbeit am Blasator darf man sich die Welt der Objekte nicht zu idyllisch vorstellen; die Atmosphäre kippt um ins Gruselige. Auf dem Kopfkissen der verstorbenen Ehefrau des leidenschaftlichen Bastlers befindet sich ein Fleck. Nicht, wie man es angesichts der zuvor eindringlich beschriebenen eisigen Temperaturen im Raum hätte erwarten können, „kaltfeucht, sondern eher lau, fast warm-feucht“ ist die Stelle auf dem Kopfkissen der schon vor Tagen Verstorbenen. Der Gast hatte sich zuvor vergewissert, dass nichts von der Zimmerdecke tropft.
Durch die nicht zusammenpassenden Temperaturen – der Kälte im Schlafzimmer des Witwers und der Wärme des Kopfkissens der Verstorbenen – führt uns der Autor aus dem Behaglichen ins Unerklärliche. Außer dem Wärme-Kälte-Empfinden sind es oft auch Gerüche, Aromen einer gruseligen Welt, die uns innehalten lassen. Die Verstorbene hat oft vor dem Einschlafen gelesen; sechzig Watt hatte die Glühbirne in der Nachttischlampe. „Am Lampenschirm kannst du den braunen Fleck sehen.“ Nach dem Zuklappen des Buchs, „meistens erst gegen Mitternacht, hat es immer schon angekokelt gerochen.“ Solche konkreten Beobachtungen machen der Reiz vieler der Texte aus, ohne dass die Geschichten realistisch daherkämen, eher mit der Eindringlichkeit eines nachlebenden Traumes.
Feindliche Dingwelt
Dinge können uns auch feindlich gegenübertreten. Das erlebt in der Titelgeschichte Im Bienenlicht der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes an der Empfangstheke des Kanzlerinnenamtes. Kleine durchschlagstarke Kampfdrohnen, bei denen man an Ernst Jüngers Zukunftsroman „Gläserne Bienen“ aus dem Jahr 1957 denken könnte, sollen die menschlichen Personenschützer ersetzen. An seinem letzten Arbeitstag im Kanzlerinnenamt rebelliert der sich fast schon im Ruhestand befindende Mitarbeiter gegen diese Entwicklung mit Hilfe einer daheim im 3-D-Drucker erzeugten Kopie seiner Dienstpistole.
Symbiosen mit Maschinen und natürlichen Organismen
Wenn Mensch und Maschine nicht gerade aufeinander schießen, kommt es zumindest zu Missverständnissen mit unseren elektrischen Freunden, wie uns am Beispiel der eingeschränkten Kommunikation mit dem Pflegeroboter Roy in der Erzählung Das Kissen vorgeführt wird. Doch nicht nur mit der Technik geht der Mensch fragwürdige Symbiosen ein, auch mit Teilen der Natur. Die Allwurzler in der gleichnamigen Erzählung sind verdienstvolle Organismen, die sich vom Plastikmüll in den Meeren ernähren. Ihre Einsatzmöglichkeiten aber sind weitaus vielfältiger, wie der Erzähler in einer kalifornischen Spät-Hippie-Kommune feststellt. Zum Einsparen des kostbaren Wassers auf den Toiletten werden solche „Allwurzler“ auch an menschlichen Körperteilen gezüchtet. Bevorzugt dort, wo Ausscheidung zu Tage tritt, kommt es zu einer befremdlichen Intimität beider Lebensformen, und die Mitglieder der Gruppe tragen aus gutem Grund weite Kleidung.
Gründliche Überarbeitung für den Wiederabdruck
Allwurzler ist eine von vier Erzählungen, die bereits in der Literaturzeitschrift Sinn und Form veröffentlicht wurden. Doch alle Texte, die zuvor an anderer Stelle erschienen sind, wurden für den Band Im Bienenlicht erneut durchgesehen und teilweise umgeschrieben. Am deutlichsten lassen sich solche nachträglichen Eingriffe vielleicht in der Erzählung David zu Ehren feststellen, die als Edition 10 der Berliner Festspiele 2014 unter dem Titel „Der Wanderer“ erschienen war, damals zusammen mit Fotos des Filmemachers David Lynch. Die eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Fotos mit Details aus Fabriken in Berlin, Lodz und Orten in den USA verbinden sich symbiotisch mit Georg Kleins düsterer Erzählung über zwei Männer, die man sich als eine ernstere Version der Ghostbusters vorstellen kann und die in ähnlichen wie in den von Lynch fotografierten Fabriken ihr riskantes Handwerk ausüben. Gelernt haben sie ihren Kampf gegen die zerstörerischen Spukerscheinungen, „Wanderer“ genannt, von einem Lehrmeister namens David, der nun nicht mehr bei ihnen ist. Für die Aufnahme des Textes in die Erzählungssammlung hat der Autor noch einmal gründlich Hand angelegt; die Hinweise auf David Lynch, die in der Broschüre von 2014 schon durch die Fotos gegeben waren, treten dabei zurück, zugunsten anderer konkreter Benennungen, zum Beispiel des Zugangscodes zur Werkstatt der beiden Männer, der in der Erstfassung nicht aufgelöst wurde.
Es wird viel gearbeitet
Vergleiche zwischen den Erstveröffentlichungen und dem jetzt erschienenen Buch vorzunehmen, wäre eine lohnenswerte Aufgabe für die Herausgeber einer historisch-kritischen Ausgabe des Georg Kleinschen Werkes; für das Lesevergnügen von Im Bienenlicht darf die Mühe der Überarbeitung unsichtbar bleiben. David zu Ehren ist nicht die einzige Erzählung, die uns in die Welt hochspezialisierter Arbeit führt. Kunstfertig und bienenfleißig sind die Menschen in Im Bienenlicht. Oft geht es um Kunst in ihren verschiedenen Spielarten, und manche der Erzählungen weisen in die Gattung der Künstlernovelle. Handwerkliches Können wird zum Thema in Wie es gemacht wird oder in Junger Pfau in Aspik, in Die Kunst des Bauchmanns oder in Der ganze Roman.
„Hochkultur“ und Kunsthandwerk
Auf einen Ausflug in die Welt der Musik nimmt uns der Erzähler in Die Melodika mit. Ein Komponist Neuer Musik, auf dessen Opus magnum die Musikwelt gespannt wartet, mag einige Ähnlichkeiten mit Hans Werner Henze aufweisen, wenngleich die vom Autor gelegten Fährten schnell wieder vom Verdächtigten wegführen. In der Ausgabe von Sinn und Form aus dem Jahr 2013 (Fünftes Heft), in der Die Melodika erstveröffentlicht wurde, bezeichnet Ina Hartwig in einem längeren Aufsatz Georg Klein als einen „Vermeidungsartisten“. Doch nicht nur, was gesellschaftlich weithin als hohe Kunst angesehen wird, steht im Zentrum der Erzählungen. In Die lustige Witwe geht es beispielsweise um einen Heimatabend mit deutschem Liedgut in einem Gasthof, und besonders eindrucksvoll werden meisterliche Architektur und Holzschnitzerei in der Erzählung Lindenried einander gegenübergestellt.
Die erste Autobahnkirche in Deutschland
Der verstorbene Onkel des Erzählers hatte als junger Architekt den Auftrag zum Bau der ersten Autobahnkirche in Deutschland erhalten; es blieb der einzige Sakralbau des großen Baumeisters, der „zeitlebens an nichts“ glaubte. Hinweise auf die historisch erste Autobahnkirche – ihre Nähe zur Stadt „A.“ (Georg Klein wurde 1953 in Augsburg geboren), die teilweise parallel zur Autobahn verlaufende Bundesstraße und auch die gemeinsame Endung „-ried“ im Ortsnamen lassen auf die Autobahnkirche „Maria, Schutz der Reisenden“ an der A 8 München–Stuttgart bei der Anschlussstelle Adelsried schließen. Dann aber enden schon die Gemeinsamkeiten zwischen möglichen Kindheitserinnerungen des Autors und der Fiktion.
Architektonisch hat die von Georg Klein ausgedachte Kirche in Lindenried mit der von Raimund von Doblhoff ab 1956 gebauten und im Oktober 1958 geweihten ersten Autobahnkirche nichts gemein. Vom Umbau einer ehemaligen Tankstelle mit denkmalgeschütztem geschwungenem Dach kann bei der tatsächlichen Kirche ebenso wenig die Rede sein wie von den Robinienstämmen, die den Innenraum der fiktiven Kirche gleich Säulen gliedern. Keine Autofiktion lesen wir, sondern eine gelungene Künstlernovelle, bei der es um die Anerkennung des jungen Holzschnitzers durch den erfahrenen Architekten geht.
Ideales Lebensende?
Die Methode, eine konkrete biografische Situation aufzugreifen und sie sehr schnell in pure Phantasie zu verwandeln, wendet Georg Klein auch bei seinem Text Herzsturzbesinnung an. Tatsächlich saß Georg Klein im Januar 2019 in der Akademie der Künste auf dem Podium – anlässlich einer Veranstaltung zum 70-jährigen Jubiläum der Literaturzeitschrift Sinn und Form. Ähnlichkeiten mit den anderen am Podiumsgespräch Teilnehmenden gibt es hingegen nicht, vor allem erlitt niemand auf dem Podium einen „Herzsturz“, wie Georg Klein dieses Phänomen als eine pandemisch sich ausbreitende, unvermittelt auftretende Todesart beschreibt, bei der sich das Herz unblutig und für den Betroffenen schmerzfrei durch die Haut nach außen stülpt und die Wahrnehmung dieses Vorgangs „kaum von einem Magendrücken nach einer überreichlichen Mahlzeit“ zu unterscheiden ist – „ganz zuletzt ein helles Brennen, mittig hinter dem Brustbein.“ Ein aus der Sicht des Erzählenden möglicherweise ideales Lebensende.
Nietzsches „Zeitreisen“
Ein biografischer Ausgangspunkt ist in Georg Kleins Erzählungen nie mehr als ein Ideengeber zu einer sich bald ins Phantastische ausweitenden Geschichte. Die Erzählung A. Zett beginnt mit einem 16-jährigen Gymnasiasten, der 1969 auf einem Friedhof einen älteren Drogenfreak kennenlernt, der lange Passagen aus dem Werk Friedrich Nietzsches aufzusagen weiß, jedoch behauptet, Nietzsche, der die Kunst des Zeitreisens beherrsche, habe sie von ihm übernommen, nicht umgekehrt. Im weiteren Verlauf beweist dieser A. Zett ein erstaunliches Geheimwissen, mit dem er dem Erzähler – nun nicht mehr ganz so jung – immer weitere Zugeständnisse abnötigt. Auf drogenähnliche Erfahrungen spielt auch Die Früchte des zweiten Baumes an. Für eine Halluzination könnte man die bewegte Figur in einer Walnusshälfte halten, Frucht eines Baumes im Garten des Cousins Gunnar. Freilich bietet Georg Klein für solche ins Unwahrscheinliche, ja ins Unmögliche, greifenden Phänomene niemals realistische Erklärungen an. Im Gegenteil, einer seiner Protagonisten wird geradezu wütend, wenn jemand ihm seine Träume „vernünftig“ erklären will – so in Wein und Brot.
Gegen Traumdeutung und Interpretation
In der bereits 2005 in [SIC] – Zeitschrift für Literatur Nr. 1 (Aachen, Berlin) erschienenen Erzählung Wein und Brot besucht ein jüngerer, nicht erfolgreicher Schriftsteller den von ihm verehrten älteren, von seinem Ruhm zehrenden, Kollegen. Der große Literat vertraut ihm einen Traum an, den der übereifrige Verehrer ihm sofort erklären möchte, womit er dem Traum jeden Zauber rauben würde. „‘Unerhört!‘, brüllt ihn der Alte da an und fegt, damit der Gast ja kein weiteres Wort wage, Wein und Gläser vom brotlosen Tisch. Mit einem Schreiberling, der so erbärmlich, der so armselig wenig vom Träumen verstehe, wolle er nichts weiter zu schaffen haben, und er verweist den Adepten für immer des Hauses.“
Georg Klein gehört einer Generation an, in deren Jugend Susan Sontags wirkungsmächtiger Essay Against Interpretation (1964) die Welt der Kunst und die Kunstkritik erschütterte. Susan Sontags Appell, ein Kunstwerk sinnlich zu erfahren und nicht mit den (damals gängigen) Methoden der Kritik und Wissenschaft zu traktieren, und die heftige Reaktion des älteren Schriftstellers in Georg Kleins Wein und Brot auf den allzu sehr Bescheid wissenden jüngeren Adepten könnten gleichermaßen eine Warnung sein, in der Literatur alles erklären zu wollen.
Der Mensch ist genial, wenn er träumt, und Georg Klein hat immer schon eine Liebe zum Surrealen und eine hohe Affinität zum Reich der Träume bewiesen. Wie in allen seinen Büchern kann auch in Im Bienenlicht die Distanz schaffende, nicht alltägliche Sprache, mit der Georg Klein seine Welten baut, genossen werden. Seine Kunst, sich in sicheren Schritten über unsicheres Terrain zu bewegen, ist zu bewundern. Auch aus seinem neuesten Erzählungsband dürften manche Bilder und Stimmungen lange nachwirken.
Georg Klein: „Im Bienenlicht“. Erzählungen. Rowohlt, Hardcover, 240 Seiten, 24 Euro.