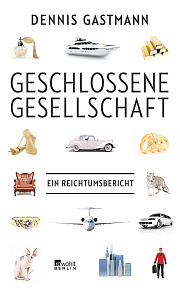„Geschlossene Gesellschaft“: Vom Glanz und Elend der Superreichen
Was macht das viele Geld mit den Reichen und Superreichen? Sind Multimillionäre und Milliardäre besonders glücklich oder besonders zerknirscht?
Derlei Menschheitsfragen wollte Dennis Gastmann mit seinem Buch „Geschlossene Gesellschaft. Ein Reichtumsbericht“ stellen – und vielleicht gar beantworten. Ist es ihm gelungen?
Nun, zunächst einmal lässt er uns weitschweifig und umständlich wissen, an welche reichen Leute er n i c h t herangekommen ist, nämlich an fast alle Berühmtheiten: „Mick Jagger? Begrüßt mein Interesse, muss jedoch absagen. Johnny Depp? Hat keine Lust.“ Und so geht die Aufzählung Seite um Seite weiter. Da stehen leider fast alle, die wirklich interessant gewesen wären. Zeigt her eure Konten? Von wegen!
Andere Journalisten hätten das langwierige, wohl auch nicht ganz billige Recherche-Projekt in dieser Phase vielleicht aufgegeben. Nicht so Dennis Gastmann, der sonst vorwiegend für die ARD-Auslandsmagazine und die Satiresendung „extra 3“ arbeitet und offenbar partout ein Buch hat füllen wollen.
Wortreich schildert er seinen wenig ergiebigen Besuch beim Playboy-Sohn Rolf Sachs. Es folgt ein Treffen mit dem „Schraubenkönig“ Reinhold Würth, der offenbar ausgeprägt sozialdarwinistisch denkt und ein Patriarch vom knorrigen alten Schlage ist; ein Getriebener, niemals vom angehäuften Mammon satt.
Da ansonsten auch hier nicht viel Brauchbares abfällt, gerät der Autor zwischendurch vollends ins Faseln. Er stellt sich vor, wie viele Coffee-to-go-Becher Würth sich für sein Milliardenvermögen kaufen könnte und wie hoch die sich türmen würden. Damit noch lange nicht genug. Es ist streckenweise eine arge Zeilenschinderei.
Dennis Gastmann schleicht sich fortan ins eine oder andere Society-Ereignis ein, beispielsweise auf Sylt, wo einem manches nicht nur halbgar, sondern auch halbseiden vorkommt. Merke: Reichtum kann gleichzeitig so schäumend und so freudlos sein. Doch irgendwie scheint Gastmann schon stolz darauf zu sein, einmal beim halbwegs großen Gelde zu hocken. Er zeigt sich von seinem Thema zuweilen mehr affiziert, als er es vielleicht gewollt hat.
Weiter geht die Hatz nach Marbella, wo Gastmann sich kurz im Dunstkreis der Bea von Auersperg bewegt. Welch eine trübe Veranstaltung und so gar kein Anlass, die Story der Dame derart auszuwalzen.
Aber Gastmann hat ja noch viel mehr im Köcher. Wir werden durch die strengste aller Butler-Schulen geführt, lernen einen Egomanen kennen, der sein Geld als Schönheitschirurg scheffelt, besuchen mit Dennis Gastmann den oberpeinlichen Berliner Alt-Playboy Rolf Eden, schnüren über die Yacht-Messe in Cannes, schauen bei einer Maklerin in Monaco und einem russischen Oligarchen vorbei, der sich im Neureichen-Kitsch suhlt und seiner Gefährtin eine weltweite Pop-Karriere finanzieren will. Uff!
Ein dekadentes Sex- und Geldmonster bildet sodann gleichsam den Gegenpol zum ungemein bienenfleißigen Trigema-Chef Grupp (der mit der Affenwerbung), einem gelegentlich cholerischen Sonderling, wenn man der Schilderung glauben darf.
Hin und wieder hat das Buch nun doch etwas Fahrt aufgenommen, und es ist dem Autor gelungen, sozusagen ein paar Brosamen vom großen Reichtum aufzusammeln. Es gibt Passagen, bei denen man sich bis zur Grusel- oder Ekelgrenze ärgern kann. Allerdings würde Neid ins Leere laufen, so erbärmlich wirken die meisten Protagonisten. Manche dieser Gestalten gieren derart nach ein bisschen Aufmerksamkeit, dass sie einem schon fast wieder Mitleid abnötigen.
Wir erfahren, dass es geradezu verbissen seriöse Spielarten des Reichtums gibt, aber eben auch halbkriminell funkelnde Formen und verblichene Restbestände. Oft genug geht jedes Maß verloren. So richtig glücklich scheint niemand mit dem übermäßigen Geldsegen zu sein, der sich denn häufig als Fluch erweist. Ein altes Lied: Ach, die armen Reichen! Kann das ein Trost sein? Und falls ja: für wen?
Dennis Gastmann: „Geschlossene Gesellschaft. Ein Reichtumsbericht“. Rowohlt Berlin. 302 Seiten. 19,95 Euro.