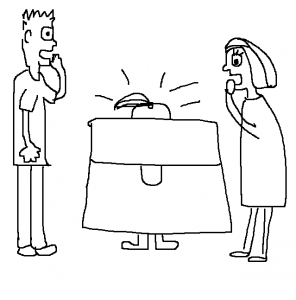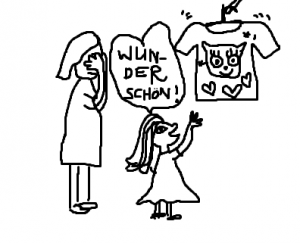„Wut und Wertung“: Geschmacks-Debatten können so verletzend sein
Das Kulturwissenschaftliche Institut (KWI) in Essen hat sich für die nächsten Monate ein übergreifendes Thema erkoren, es nennt sich „guilty pleasures“, was etwas umständlich mit „schuldbesetzte Vergnügungen“ übersetzt werden könnte. Freuden also, die man mit einigermaßen schlechtem Gewissen genießt – Flugreisen etwa oder exzessiven Medienkonsum der seichteren Art. Oder auch kulturelle Vorlieben, die dem waltenden Zeitgeist zuwiderlaufen.
Zum Themenauftakt gab es dieser Tage eine (auch online zu verfolgende) Diskussionsrunde mit Johannes Franzen von der Universität Siegen. Der auch als Journalist (Zeit, Taz, FAZ) tätige Germanist und Anglist hat ein Buch über widerstreitende kulturelle „Geschmäcker“ geschrieben. Griffig zugespitzter Titel: „Wut und Wertung. Warum wir über Geschmack streiten“.
Üble Attacke auf der Party
Nun mögen sich manche souverän erhaben dünken, wenn es um ihre (allzeit gefestigten? bestens begründeten?) Geschmacksurteile geht. Franzen hingegen stellt eine fiktive, aber nicht ganz unwahrscheinliche Szene an den Anfang seines Buches, die ihm zufolge das Verletzungs-Potenzial von Geschmacksunterschieden offenbaren soll: Denken wir uns eine Party, auf der jemand einen Film über den grünen Klee preist, der auch emotional ungemein fesselnd sei. Da erhebt ein anderer Gast seine wortgewaltige Stimme und attackiert diese Auffassung als naiv und lächerlich. Welch eine Bloßstellung vor all den Leuten! Und welch ein Distinktions-Gewinn für den eloquenten Angreifer, der wohl fulminant „gepunktet“ hat. Ergo: Geschmacks-Konflikte können ziemlich verletzend sein.
Ironisch die Neigung zum „Kitsch“ gestehen
Wie wirkt sich das aus, wenn jemand mit seinen ästhetischen Vorlieben derart in Erklärungsnot und in eine womöglich peinliche Defensive gerät? Möchte er/sie nicht im Boden versinken? Oder zum Gegenangriff übergehen? Immerhin liegen, so Franzen, einige Techniken der Befriedung bereit, allen voran das alte, reichlich verschnarchte Diktum „Über Geschmack lässt sich nicht streiten“. Auch könnte eine Reaktion darin bestehen, dass man ironisch seine gelegentlichen Vorlieben für „Kitsch“ eingesteht (womit wir bei den eingangs erwähnten „guilty pleasures“ angelangt wären) und dem Widersacher Wind aus den Segeln nimmt. Überdies wirken der allgemeine Aufstieg der Populärkulturen sowie der Niedergang der „Hochkultur“ und des klassischen Kanons in solchen Fragen vermutlich entlastend. Die Zeiten der allmächtigen „Kulturpäpste“ sind eben vorüber.
Wenn sich jeder Mensch als Kritiker aufspielt
Dennoch: Zweifel am eigenen Geschmack sind wahrscheinlich allgegenwärtig. Selbst die Beschäftigung mit einem unstrittigen Genie wie Shakespeare sei nicht unbedingt davor gefeit. Franzen nennt mögliche Beispiele: „Kann ich überhaupt gut genug Englisch, um urteilen zu können? Habe ich vielleicht die weniger guten Inszenierungen gesehen?“ Und schon steckt man in der Falle…
Zu bedenken ist ferner der Unterschied zwischen professioneller und laienhafter Rezeption, der freilich im Internet, wo sich heute quasi jeder Mensch als Kritikus aufspielen kann, tendenziell zu schmelzen scheint. Ästhetischer Purismus scheint jedenfalls rasant auf dem Rückzug zu sein.
Was der „innere Deutschlehrer“ anrichtet
Im Verlauf der Diskussion wurde auch das Phänomen des „inneren Deutschlehrers“ gestreift, der einem seit Pennäler-Zeiten als kulturelles Über-Ich im Kopf sitzt und schulische „Zwangslektüren“ wie etwa Fontanes „Effi Briest“ nachhaltig vergällt. Mit dem herrschenden Kanon und solcher Pflicht-Rezeption werde ein lang andauernder „kultureller Gehorsam“ eingeleitet, hieß es. Dieser wirke oft auch im Streit über Geschmacksfragen nach. Wobei so manche Meinungsverschiedenheit ja nicht gleich zu Wutausbrüchen oder Verletzungen führen muss, sondern im gepflegten Gespräch (aka herrschaftsfreier Diskurs) einfühlsam erörtert werden mag. Längst nicht alle Leute sind Wutbürger, (hoffentlich) erst recht nicht die kultursinnigen.
Die Entgleisung des Clemens Meyer
Zu Beginn des Abends hatten Franzen und das Moderations-Duo (Stefan Hermes, Uni Duisburg-Essen, Roxane Phillips vom KWI) geradezu dankbar eine aktuelle Wut-Entgleisung im Literaturbetrieb aufgegriffen; auch dies wohl ein „guilty pleasure“, weil ziemlich boulevardesk. Anlässlich der Vergabe des Deutschen Buchpreises an Martina Hefter (für „Hey guten Morgen, wie geht es dir?“) hatte der auf der Shortlist konkurrierende Clemens Meyer („Die Projektoren“, 1056 Seiten) die Jury-Entscheidung unflätig kommentiert und damit ein beinahe größeres Medienecho ausgelöst als die eigentliche Preisvergabe. Mal wieder einer dieser ach so skandalösen Fälle von Wut und Wertung, von denen die Literaturgeschichte und die Historie anderer Künste überquellen.
Johannes Franzen: „Wut und Wertung. Warum wir über Geschmack streiten“. S. Fischer Verlag. 432 Seiten, 26 Euro.