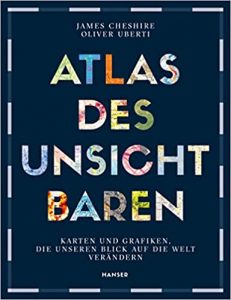Abbilder der Verhältnisse – im „Atlas des Unsichtbaren“
Sinnreiche Visualisierung komplexer Sachverhalte ist eine Kunst, auf die sich nicht viele verstehen. Im Netz geht neuerdings der Auftritt „Katapult“ steil, der auch verwickelte Dinge auf möglichst simple optische Umsetzungen „herunterbricht“ – mit wechselndem Geschick: Manches, aber längst nicht alles gelingt. In den „Atlas des Unsichtbaren“ sollte man sich hingegen einigermaßen vertiefen. „Auf einen Blick“ erlangt man hier nicht viel.
Die Autoren James Cheshire und Oliver Uberti versprechen laut deutschem Untertitel recht vollmundig „Karten und Grafiken, die unseren Blick auf die Welt verändern“. Die Kapitelüberschriften („Woher wir kommen“, „Wer wir sind“, „Wie es uns geht“, „Was uns erwartet“) erweisen sich als wenig trennscharf und taugen nicht zur Sortierung. Also heran an die vielen Einzelheiten, die eben nicht in solche Schubladen passen.
Nach und nach zeigt sich, dass Kartographie und graphische Darstellungen weitaus mehr vermögen, als sich der Diercke-Schulatlas träumen ließ. Manches lässt sich veranschaulichen, was vorher undurchdringlich schien, verblüffende Ein- und Durchblicke werden möglich. Auch Statistiken und Tabellen sind kein leerer Wahn, wenn sie mit Verstand eingesetzt werden.
Da zeigt eine Schautafel ganz schlüssig, ob und wie sich die Gene über 14 Generationen hinweg (etwa seit 1560) noch vererben. Neue Klarheit verschaffen Karten zu den Strömen des Sklavenhandels oder über Walfänge seit 1761. Der Aufschlüsse sind viele: Migrations- und Pendlerrouten, Mobilfunkdaten oder eine Karte zur Lichtstärke in Städten und Regionen verdeutlichen soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge. Sie können als Ergänzung zu wortreich differenzierten Betrachtungen sehr brauchbar sein.
Häufig wird der globale Maßstab angelegt, bevorzugt aus angloamerikanischer Perspektive: In welchen US-Staaten kommt Lynchjustiz besonders häufig vor? Inwiefern lassen Gebäudedaten auf künftige Gentrifizierung schließen, so dass Prognosen dazu einen höheren Wahrscheinlichkeitsgrad haben? Wo leisten Frauen im Verhältnis zu Männern die meiste unbezahlte Arbeit (Indien) und wo die wenigste, aber immer noch deutlich über 50 Prozent (Schweden)? In welchen Ländern erleiden Frauen die meiste physische Gewalt?
Durch graphische Umsetzung werden auch die Muster der US-Bombardierungen im Vietnamkrieg gleichsam „transparenter“. Übrigens hat Ex-Präsident Bill Clinton die zugrunde liegenden Daten freigegeben. Freilich wirken solche fürchterlichen Sachverhalte in atlasgerechter Aufbereitung leicht zu harmlos. Auf diese Weise können eben nur bestimmte Dimensionen des Geschehens vermittelt werden. Dessen eingedenk, blättern wir weiter.
Das letzte Konvolut („Was uns erwartet“) handelt – man durfte gewiss damit rechnen – überwiegend vom bedrohlichen Klimawandel, so gibt es etwa Karten über weltweite Hitzewellen und Stürme oder zur Eis- und Gletscherschmelze. Auch erfährt man zum Beispiel, auf welchen Flugrouten künftig erheblich mehr Turbulenzen bevorstehen dürften. Hilfreich jene Sonnenlicht-Karte, die quasi jeden Quadratmeter eines bestimmten Gebiets im Hinblick auf Sonneneinstrahlung (Intensität, Dauer, zeitlicher Verlauf) definiert, so dass im Winter das Streusalz praktisch punktgenau verteilt werden kann und nichts verschwendet wird. Viele Flächen tauen eben auch rechtzeitig ohne Salz auf.
Ein Buch zum gründlichen Durchsehen, lehrreich, hie und da von echtem Nutzwert, dies aber von begrenzter Dauer. Denn solche Datenbestände und folglich die Karten altern leider ziemlich schnell.
James Cheshire / Oliver Uberti: „Atlas des Unsichtbaren. Karten und Grafiken, die unseren Blick auf die Welt verändern.“ Aus dem Englischen von Marlene Fleißig. Hanser Verlag, 216 Seiten (Format 20 x 25,5 cm), 26 Euro.