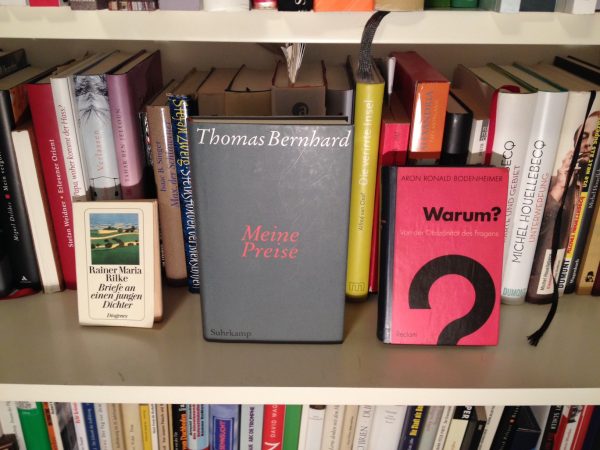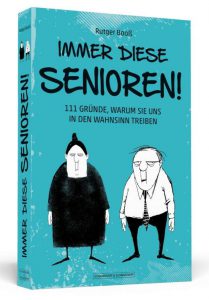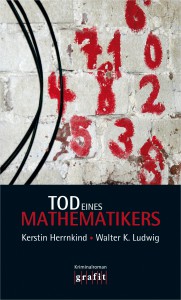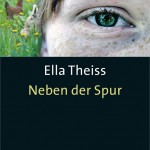Literarische Verlage und der Literaturbetrieb im Ruhrgebiet: Förderung nur noch für Glamour?
Seitdem der Klartext Verlag sein karges literarisches Programm nahezu ganz einstellte und der Dortmunder Grafit-Verlag nach Köln umzog, existieren nur noch inhabergeführte Klein- und Selbstverlage längs der Ruhr. Von einer Kultur- als Verlagsmetropole kann an deren Ufern wahrlich keine Rede sein. Zudem wird ein jährlich mit 500.000 Euro gesponserter Show-Platz wie die lit.RUHR von Köln aus bespielt.
Ruhr-Stiftungen, das Land NRW und der Regionalverband Ruhr stecken Millionen an Fördergeldern in Hochglanzbroschüren, Festivals, Galas oder Blenderprojekte der Creative Economy wie das Kreativwirtschaftsorakel „ecce“. Zur Belebung des Literaturmarktes führte das aber hierzulande nirgends.
Auch weil bundesweit stärker ausstrahlende Verlage fehlen (von TV- oder Radiosendern ganz zu schweigen), vermisst man im Revier ein lebendiges literarisches Leben mit Autoren, Literaturkritikern, Lektoren oder Illustratoren. Und der „Kultur & Freizeit“-Teil der zum Verwechseln ähnlichen Funke-Zeitungen ersetzt mit täglich anderthalb Seiten auch zu „Kinder – Wetter – Leute – Panorama“ kein Feuilleton von Rang – an solch eingeschränkten Arbeitsbedingungen in den Redaktionen ändern selbst engagierte Journalisten wenig.
Für 2,95 € im Klartext-Online-Shop: Magnet „Merkse noch wat?“
Nachdem Dr. Ludger Claßen 2016 nach gut drei Jahrzehnten den Klartext Verlag Essen verlassen hatte und der neue Geschäftsführer (auch zuständig für die „Koordination Marken und Events“ der Funke Mediengruppe) das literarische wie das wissenschaftliche Programm des Verlages fast auf null stellte, wird es für junge Autorinnen und Autoren aus dem Ruhrgebiet nahezu unmöglich, ihr literarisches Debüt mit einem regionalen Verlag zu wagen. Klartext verkauft lieber Ratgeber, Reiseführer und Folkloreartikel wie die Brotdose „Kniften“, oder austauschbare Non-Book-Souvenirs wie das Glaslicht „Osnabrück“ (auch in den Varianten „Hamburg“, „Bremen“, „Köln“ …). Und für nur 2,95 € gibt’s einen Magneten mit der Aufschrift „Merkse noch wat?“
Überhaupt Köln: ein starkes Stück Ruhrgebiet
Der Grafit Verlag, einst von Dortmund aus tonangebend im bundesweiten Konzert der Lokal- und Regionalkrimiszenen, ist nach Köln verkauft worden. Mit ihm verließ der letzte halbwegs größere literarische Verlag das Ruhrgebiet. Jetzt gehört Grafit dem kölschen Emons Verlag. Auch vieles andere im Literaturbetrieb Ruhr wird heutzutage von Kölnern gedeichselt. Rainer Osnowski und andere bringen nicht nur die lit.COLOGNE, sondern im Oktober gleich nach der lit.RUHR auch die lit.COLOGNE Spezial auf die Bühnen; manches im Programm überschneidet sich da, nur Stars wie Rusdie oder Colson Whitehead behält man lieber exklusiv Köln vor. Aus der dortigen Maria-Hilf-Straße inszenieren die Festival-Macher all das über die lit.Cologne GmbH oder die „litissimo gGmbH zur Förderung der Literatur und Philosophie“. Und selbst vom Stadtschreiber Ruhr hieß es: „Die Lit.RUHR (also Köln, G.H.) unterstützt die Brost-Stiftung beim Projekt ,Stadtschreiber(in) Ruhr’“.
 „Bücher vonne Ruhr“: Bücher von (dieser) Welt
„Bücher vonne Ruhr“: Bücher von (dieser) Welt
Nur gut, dass es in Bottrop immer noch und zunehmend deutlicher sichtbar den Verlag Henselowsky Boschmann gibt. Verleger (und Autor) Werner Boschmann versucht mit Reihen („Ruhrgebiet de luxe“), Anthologien und starken Einzeltiteln mehr zu bieten als nur einen Kessel Buntes rund ums Ruhrgebiet. Selbstironisch nennt er seinen Verlag „Regionaler Literaturversorger Ruhrgebiet“, doch viele Leser und Autoren kommen längst nicht mehr nur aus dem Ruhrgebiet, wie man etwa aus den Bio-Bibliografien der Autoren des „Vorbilderbuch. Kleine Galerie der Menschlichkeit“ erfahren kann.
Auch die Bücher der international ausgezeichneten Kinder- und Jugendbuchautorin Inge Meyer-Dietrich oder die des Filmemachers Adolf Winkelmann verhandeln zwar das Ruhrgebiet und seine Geschichte(n), sind aber frei von jedem Provinzmief. Ein neuer Autor wie Ruhrbarone-Blogger Stefan Laurin hält in „Versemmelt. Das Ruhrgebiet ist am Ende“ Politik, Verwaltung und ihren taumelnden Satelliten drastisch den Spiegel vor: „Das Ruhrgebiet hatte viele Möglichkeiten; die meisten hat es nicht genutzt. Keine Region Deutschlands, ja Europas, von dieser Größe wird dilettantischer regiert. Verantwortlich hierfür waren und sind die Menschen, die all das mitgetragen haben.“
Man kann nur hoffen, dass Henselowsky Boschmann sein freches Programm inhaltlich weiterentwickelt, also die Balance zwischen regionaler Verwurzelung und weltoffenem Horizont immer wieder neu und besser auspendelt. Auf Unterstützung oder kleine Subventionen aus dem kunstfernen Regionalverband Ruhr wird der Verlag dabei erst gar nicht hoffen dürfen.

Jürgen Brôcan: Lyriker, Verleger, Übersetzer, Kritiker. Foto: Jörg Briese
edition offenes feld
Sehen lassen kann sich auch das rein literarische Programm des Dortmunder Verlegers, Übersetzers und Kulturjournalisten Jürgen Brôcan. 2016 erhielt er für sein lyrisches Gesamtwerk den Literaturpreis Ruhr. Über seinen Verlag, der mindestens drei Titel pro Jahr herausbringt, schreibt er:
„Das Programm der „edition offenes feld“ (eof) ist auf Vielfalt der Gattungen und Stile ausgerichtet. Klassiker in Übersetzung, arrivierte Autoren aus verschiedenen Ländern und Entdeckungen in Lyrik und Prosa sollen zum Facettenreichtum der Literatur beitragen.“
Und dass dies Brôcan auch gelingt, dafür bürgen Autoren wie Ranjit Hoskoté, Spoon Jackson oder die Lieder des chinesischen Poeten Zhou Bangyan aus Zeiten der Song-Dynastie.
Last but not least: Rigodon Verlag und andere Solitäre
Ich bin sicher: Einige wenige Special-Interest-, Klein-, Kleinst- und Selbstverleger habe ich aufzuzählen vergessen. Nicht vergessen werden aber darf das aus all dem hervorrragende „Schreibheft“ Norbert Wehrs, das vom Rigodon Verlag in Essen herausgegeben wird und es zu internationaler Geltung gebracht hat. Vergessen sollte man auch nicht die Edition Wort und Bild des Bochumer Dichters und Grafikers H.D. Gölzenleuchter. Seit 1979 gibt Gölzenleuchter Lyrik, Prosa und Mappen mit literarischen Texten und Originalgrafiken heraus. In der Zusammenarbeit von Autoren und Grafiker sind feinste bibliophile Drucksachen entstanden.
Ob nun Norbert Wehr, H.D. Gölzenleuchter, Klauspeter Sachau und sein ‚vorsatzverlag‘ in Dortmund, ob nun Werner Boschmann oder Jürgen Brôcan: Das finanzielle Risiko der Herausgabe eigener und fremder Texte tragen sie immer ganz persönlich. Glücklich, wer nach Jahrzehnten freier Verlagstätigkeit irgendwo irgendwann einen Preis erhält, an dem auch ein Scheck hängt.

Beim RVR verleiht man gern preiswert Literaturpreise – je mehr, desto besser. Foto: Jörg Briese
Statt Muse: Almosen
Norbert Wehr erhielt 2010 angesichts seiner Lebensleistung fürs „Schreibheft“ den Hauptpreis zum Literaturpreis Ruhr, immerhin mit 10.000 Euro dotiert. Das war damals möglich, weil nicht nur Schriftsteller mit dem Hauptpreis ausgezeichnet werden konnten, sondern gelegentlich auch hochverdiente Verleger, Kritiker, Wissenschaftler und Archivare.
Der Regionalverband Ruhr will auch das nun ändern und hat für Verleger ab 2020 voraussichtlich nur noch einen Talmi- Ehrenpreis übrig. In einer Beschlussvorlage des Ausschusses für Kultur und Sport beim RVR hieß es kürzlich so bürokratisch wie genderkorrekt:
„,Mit dem Ehrenpreis des Literaturpreises Ruhr werden eine oder mehrere Personen oder eine Institution für herausragende Verdienste um die Literatur im Ruhrgebiet oder für das literarische, literaturwissenschaftliche, literaturkritische, organisatorische oder verlegerische Gesamtwerk ausgezeichnet.‘ Dieser Preis ist kein Jurypreis, sondern der RVR bestimmt gemeinsam mit dem Literaturbüro Ruhr den bzw. die Preisträger*in. Der Preis wird nach Bedarf und nicht jährlich vergeben. Der bzw. die Gewinner*in erhält einen Preis in einer noch zu bestimmenden Form. Dieser kann z.B. eine von einem bzw. einer Künstler*in gestaltete Skulptur/Statue sein.“
Ehrloser Ehrenpreis
Ich sehe es schon vor mir und würde mitleiden, falls etwa der virtuose Holzschneider H.D. Gölzenleuchter von einem linkischen Ausschuss-Vorsitzenden eine gemäß Parteien-Proporz gestaltete Stilmix-Statuette in die Hand gedrückt bekäme, die nun wiederum dem HAP Grieshaber-Bewunderer Gölzenleuchter Tränen des Entsetzens in die Augen treiben dürfte.
Sehr viel lieber ist mir daher die Vorstellung, dass ab 2020 niemand diesen Dumping-„Ehrenpreis“ annehmen wird: Deutlicher als mit ihm hätten die hochbestallten Kulturverweser des RVR ihre Geringschätzung editorischer Leistungen in der Verlags-Diaspora des Reviers nicht ausdrücken können. Und wahrscheinlich bemerken sie wieder nicht, was sie da anrichten.