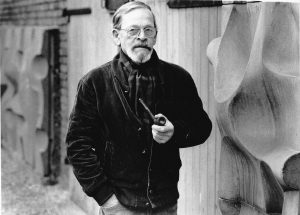Vor wenigen Tagen hat unser Gastautor Heinrich Peuckmann an dieser Stelle einige prägende Begegnungen aus seiner Schulzeit skizziert. Lauter kultivierte Lehrer haben sich demnach in Kamen und Unna die Klinke in die Hand gegeben. Das klang – wenigstens im Rückblick – alles sehr zielgerichtet und schicksalhaft vorherbestimmt; ganz so, als hätte es gar nicht anders kommen können, als dass Peuckmann selbst zum Lehrer und Schriftsteller wurde.

Nur als Beispiel fotografiert: eine altehrwürdige Lehrstätte – weit im Osten der Republik; also keineswegs das im Revier liegende Institut, von dem im Text die Rede ist. (Foto: Bernd Berke)
Heinrich Peuckmann hat offenbar großes Glück gehabt. Ich glaube, dass nicht viele aus unserer Generation so gut und günstig über ihre Schuljahre sprechen können. Meistenteils war es doch ein Kreuz mit der Penne. Wir reden hier übrigens vornehmlich von den 60er Jahren. Die Grundschule und ein späteres Gymnasium in Bonn lasse ich mal beiseite, damit es halbwegs übersichtlich bleibt.
Angebliches „Elite-Gymnasium“
In medias res: Unser Institut galt innerhalb Dortmunds als „Elite-Gymnasium“. Zumindest sahen die Herrschaften des Lehrkörpers sich selbst gern so. Das Einzugsgebiet erstreckte sich bis weit in den schon damals „feineren“ Süden der Stadt. Koedukation war leider noch ein Fremdwort, also muss man es so sagen: Da gab’s schon einige Söhnchen aus begüterten Familien.
Mit solch einem gediegenen Hintergrund konnten ich (und etliche andere) nicht dienen. Ich bin im seinerzeit kleinbürgerlichen Kreuzviertel aufgewachsen, das erst sehr viel später schick und studentisch alternativ wurde. Meine Mutter war unter den Eltern der ganzen Klasse die einzige Frau, die arbeiten ging – ein Umstand, über den manche Lehrer die Nasen gerümpft haben. So beschränkt waren die Zeiten.
Wissensvermittlung Nebensache
Bert Brecht war es wohl, der sinngemäß geschrieben hat, Aufgabe eines Lehrers sei nicht so sehr die Wissensvermittlung. Vielmehr müsse sich der Pädagoge vor der Klasse möglichst schrankenlos ausleben, auf dass die Schüler verschiedene Menschentypen bis auf den Grund kennen lernten. In diesem Befund waltet Weisheit, die unter gewandelten Vorzeichen vielleicht heute noch gilt.
Anders als bei Heinrich Peuckmann, saßen bei uns neben- oder hauptberufliche Schriftsteller schon mal gleich gar nicht im Kollegium. Die Deutschlehrer mochten sich daheim in stillen Stunden von Herzen für Schiller, Hölderlin oder Rilke begeistern, wirklich gespürt haben wir derlei Leidenschaft nur in sehr seltenen Momenten. Wenn überhaupt.
Ach, Hubertus…
Eine recht junge Lehrerin, gerade dem Referendariat entronnen, besprach mit uns immerhin auch Lyrik von Enzensberger und Celan oder seinerzeit virulente Romane von Grass und Max Frisch. Damals beileibe keine Selbstverständlichkeit.
Freilich blieb auch sie der rein textimmanenten Interpretation jener Jahre verhaftet. Wenn wir über Klassenarbeiten brüteten, las sie am Pult geradezu demonstrativ die stocksolide und erzkonservative Frankfurter Allgemeine Zeitung, mutmaßlich vor allem Feuilleton-Riemen von Friedrich Sieburg oder Benno von Wiese. Ihr persönlicher Primus war ein Mitschüler mit Adelsnamen, welchen sie geradezu andächtig hauchte. Ach, Hubertus…
Als Geschichtslehrerin ließ sie am liebsten allerlei Jahreszahlen auswendig lernen. Gern hielt sie sich in frühen Epochen auf, weit von der garstigen Zeitgeschichte entfernt.
Käuze und Sonderlinge
Um schöne Nebensachen nur kurz zu streifen: Die Musiklehrer lebten auf ihrem eigenen Stern, sie waren vergleichsweise in Ordnung. Einer versuchte gar kurz, die Beatles zu thematisieren. Doch er drang damit nicht zu uns durch. Auf dem Gebiet mochten wir uns erst recht nicht von der Schule einfangen lassen.
Die beiden Bio-Lehrer waren eher groteske Käuze, irgendwie rührend in ihr Fachgebiet vernarrt. Harmlos also. Aber auch nicht allzu lehrreich. Später kam Chemie hinzu – bei einem veritablen Schleifer. Von Physik wollen wir schweigen und allenfalls andeutungsweise das Bild von der schiefen Ebene bemühen. Der Französischlehrer war eine Witzfigur, von keinerlei subtilem Geist angekränkelt.
Ostpreußische Orte suchen
Andere aber waren schlimmer. Ein froschhafter Fettmops von Mathepauker, der uns aus unerfindlichen Gründen auch in Sport quälen und trimmen durfte, krähte gern mal Sprüche wie „Häää, wer nich Schwimm‘-kann-kann-auch-keine-Mattmattik!“ Tatsächlich hatten die schlechten Schwimmer in Mathe von vornherein schlechtere Karten bei ihm. Erklären konnte er eh nix, nur abfragen und Urteile fällen. Danach suchte uns ein notorischer Säufer heim, der (im Krieg?) seinen Daumen verloren hatte und trotzdem gerade mit den Fingern jener Hand unverdrossen zählen wollte. Das Kichern zu vermeiden, glich einer Herkulesaufgabe.
Doch andere waren schlimmer. In Erdkunde hatten wir zunächst einen üblen Revanchisten, der aus Ostpreußen stammte, uns folglich immer wieder an der Landkarte der Ostgebiete strammstehen und Orte suchen ließ. Wehe, wenn man sie nicht fand… Wie? Ach ja, natürlich hat er uns vorgemacht, wie es im Schützengraben gewesen ist, als es gegen den Iwan ging. Ratatatata.
Mit der Faust ins Gesicht
Doch andere waren noch schlimmer: Der Lateinlehrer, ein Schmierlapp, der sich elend leutselig geben konnte und seinen Lieblingsschülern sogar schon mal zärtlich über den Kopf strich, konnte andererseits brutal mit der Faust zuschlagen – mitten ins Gesicht. Wenn man daran denkt, spürt man heute noch ein knotiges Unwohlsein in der Magengegend – und könnte ihm seinerseits die Fresse polieren. Warum soll ich’s vornehmer sagen? Und der Kerl hat nebenher auch noch katholische Religion gegeben. Ausgerechnet.
Gewaltausübung durch Lehrer war damals bei einigen Gestalten überhaupt an der Tagesordnung, heute müssten sich die Herren dafür hochnotpeinlich verantworten. Selbst ein Kunstlehrer (!) hatte eine üble Methode, uns heftig an den Ohren zu ziehen und selbige schmerzhaft zu zwirbeln. Möge er in Hieronymus Boschs Welten getriezt werden.
„Tack, tack, tack“ – „Werd‘ doch Friseur“
Ins Englische wurden wir gerade mal leidlich eingeführt – von einem drahtigen Schönling, der zu Zeiten der ersten Bond-Filme wie 007 Sean Connery aussah. Drum war auch der Sportunterricht seine eigentliche Domäne. Wollte er, dass wir uns beeilen, hackte er im militärischen Rhythmus mit seinem Schlüsselbund auf den Lehrertisch und rief dazu „Tack-Tack-Tack!“ In der Mittelstufe kam dann ein richtiger Englischlehrer, der über seinen Vorläufer mitleidig lächelte und sein geballtes promoviertes Wissen auf uns losließ. Er nötigte denn doch Respekt (und Furcht) ab, dachte zudem ausgesprochen elitär. Wer schlecht abschnitt, dem riet er unumwunden: „Werd‘ doch Friseur!“
Schäbige Rache der Pubertierenden
Nach all dem war es eigentlich kein Wunder, dass wir uns als Pubertierende für erlittene Unbill gerächt haben – bei den schwachen Figuren. So haben wir einen schwer zuckerkranken Erdkunde-Lehrer, der körperlich nur noch ein bedauernswerter Hänfling auf spindeldürren Beinchen war, bis zur Weißglut gereizt. Für diese feige Infamie schäme ich mich bis heute. Und nicht nur mir geht es so.
Noch immer frage ich mich, worauf eine solche Schullaufbahn (nein: Geisterbahn) eigentlich hinauslaufen sollte. Gewiss, wir haben ein paar Fakten, Formeln und Vokabeln gelernt. Doch von all dem Stoff konnte man später im Beruf ca. 95 Prozent getrost vergessen. „Non scholae, sed vitae discimus“ (Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir) war einer der lächerlichsten Sätze, die uns je untergekommen sind.