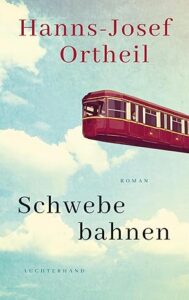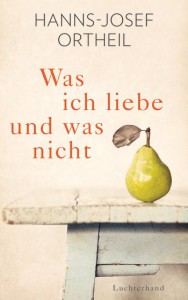Ausgegrenzt in Wuppertal: Hanns-Josef Ortheils Kindheits-Roman „Schwebebahnen“
Eigentlich wollte der 1951 in Köln geborene Hanns-Josef Ortheil Pianist werden. Doch massive Sehnenscheidenentzündungen zerstörten den Traum. Also schrieb er Romane, gründete in Hildesheim den Studiengang für „Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus“ und gehört seit vielen Jahren zu den meistgelesenen deutschen Gegenwarts-Autoren. Sein neuer Roman, „Schwebebahnen“, kreist um imaginäres und reales Schweben: Die Familie zieht Ende der 1950er Jahre von Köln nach Wuppertal.
Der sechsjährige Josef, ein leicht verfremdetes Abziehbild des Autors, ist sofort fasziniert von der Hochbahn, die über die Wupper dahin schwebt. Josef malt sich aus, wie die Bahn einfach in den Wolken entschwindet. Die Schwebebahn wird zur Metapher: für die von Kaltem Krieg und atomaren Wettrüsten gefährdete Welt; für den fragilen Zustand Josefs, der seit seinem dritten Lebensjahr Klavier spielt, täglich seine Gedanken aufschreibt, aber von seinen Mitschülern gehänselt und ausgegrenzt wird; schließlich gilt das existenzielle Verunsichertsein auch für Josefs von Trauer und Schweigen umwölkte Eltern. Ortheil schildert das Drama des begabten Kindes, das sich in künstlerische Fantasiewelten flüchtet, von seiner Umwelt aber zum schrägen Außenseiter abgestempelt wird.
Man darf annehmen, dass Ortheils Roman auf den schwarzen Kladden fußt, die er seit Kindertagen mit Notizen füllt: ein Fundus an Geschichten, Basis seiner Literatur. Im Umzugswagen von Köln nach Wuppertal denkt Josef darüber nach, was sein Vater gemeint haben könnte, als er zu jemandem sagte, sein Junge sei ein „stilles Kind, das zurückgezogen lebt“ und lieber Klavier spielt, anstatt viel zu reden. Der sich in Josef einfühlende Ortheil schreibt: „Weil er jeden Tag übt, hat er wenig Zeit, sich lange zu unterhalten. Er wüsste auch nicht worüber, andere Jungs haben Themen, von denen er wenig oder nichts versteht. Er unterhält sich mit sich selbst, das tut er leise und heimlich, aber auch mit dem Stift und auf Papier. Beim Schreiben ordnen sich die Gedanken und machen im Kopf sogar etwas Musik. Sie erscheinen wie lebendige Wesen, die anklopfen, auftreten und freundlich wieder verschwinden.“
Auch in Wuppertal wird Josef belächelt, weil er sich aus dem Unterricht wegträumt und Geschichten erfindet. Die Jungs im Wohnviertel finden ihn blöd, weil er sich nicht für Fußball interessiert. Im Mietshaus beschweren sich die Bewohner über sein lautes Klavierspiel. Aber zum Glück findet er in Mücke, die eigentlich Rosa heißt, eine Freundin und Vertraute. Sie kümmert sich um Josef, zeigt ihm ihre von geheimnisvollen Engeln bewohnte Höhle draußen im Wald und verbündet sich mit ihm gegen die Dummheit der Welt. Auch lernt Josef bei einem Musiker das Improvisieren und Komponieren und darf, wann immer er will, in der Kirche Klavier spielen. Aber die Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat, ist schnell vorbei. Nur die Faszination der Schwebebahnen wird bleiben.
Hanns-Josef Ortheil: „Schwebebahnen“. Roman. Luchterhand Verlag, München 2025, 320 Seiten, 24 Euro.