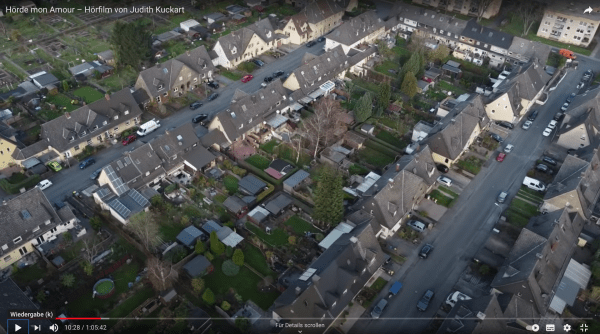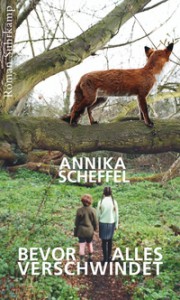Dortmund im Zwiespalt: Revier, Westfalen oder beides?

Die WESTFALENhalle bei Nacht, aus einem fahrenden Auto heraus aufgenommen im März 2008. (Foto: Bernd Berke)
Tja, Westfalen. Gut und schön. Aber wohin wendet man sich heimatlich, wenn einen das Leben nach Dortmund verschlagen hat?
Die Stadt nennt sich seit Jahrzehnten „Westfalenmetropole“ (und wetteifert dabei mit dem kleineren, aber doch wohl feineren Münster), reklamiert aber auch – mit nicht weniger Recht – für sich, die größte Gemeinde des Ruhrgebiets zu sein. Zumindest nach Einwohnerzahl gerechnet, lässt die Stadt auch (das beinahe schon rheinische) Essen hinter sich.
Sicher, Westfalen hat eindeutig die längere Tradition und hat just 2025 gar das 1250. Jubiläum gefeiert, die Datierung des Namens ist durch historische Zeugnisse unzweifelhaft belegt. Das Ruhrgebiet ist hingegen erst im 19. Jahrhundert entstanden. Wollte man sich also auf Althergebrachtes beziehen, müsste Westfalen zur Wiege erkoren werden. Damit gehen sozusagen ländlich-sittliche Assoziationen einher, ein zu großen Teilen bäuerlich geprägter Lebenswandel wäre die ursprüngliche Grundlage.
Mit dem Revier verhält es sich gründlich anders. Hier, in diesem Schmelztiegel aus so vielen Herkünften, zählt denn doch eher das städtische Treiben, wobei die vielen Vororte oft ländlich oder vollends gestaltlos zersiedelt anmuten. Dortmund ist freilich, sehr lange vor Kohle, Stahl, Bier und Fußball, Hansestadt und Freie Reichsstadt gewesen, an Tradition den anderen westfälischen Landstrichen jedenfalls ebenbürtig. Als „Throtmanni“ wurde es schriftlich bereits zwischen 880 und 884 erwähnt. Das wäre dann auch rund 1145 Jahre her. Kaum zu glauben, wenn man sich heute durch die Stadt bewegt, die im Weltkrieg so zerstört wurde wie kaum eine andere.
Der Zwiespalt hat sich beispielsweise auch in den Titeln der örtlichen Dortmunder Zeitungen manifestiert. Da trat eben die Westfälische Rundschau gegen die Ruhrnachrichten an. Anders gewendet und in die Nachbarschaft geblickt: Bochum hat sein Ruhrstadion, Dortmund sein (kommerzhalber anders beschriftetes) Westfalenstadion und die Westfalenhalle.
„Ruhrpottkind, auf Kohle geboren“,
so lautet eine vielfach verwendete, lakonisch klingende, doch fast schon pathetische Selbstkennzeichnung, die manche Leute als Tattoo mehr oder weniger unauslöschlich mit sich herumtragen. Vor allem aus Kindertagen weiß ich, was das auch bedeutet. Ruß und Rauch überall, in gewisser Verdünnung bis hinein in die etwas betuchteren Stadtteile. Zuweilen Atemnot und stets schnellstens ergraute weiße Wäsche, was einen als Kind allerdings weniger betrübt. Na, und so weiter. Ginge es nur ums bessere Image, so müsste sich Dortmund flugs zur westfälischen Kapitale erklären.
Seit den rußigen Zeiten hat es so manchen Strukturwandel gegeben, so dass Dortmund heute mit großen Versicherungen und Software-Firmen längst nicht mehr spezifisch regional geprägt ist – weder sonderlich westfälisch noch reviertypisch. Über Jahrzehnte hatten wir Dortmunder mit Bewohnern Duisburgs oder Gelsenkirchens sicherlich mehr gemeinsam als etwa mit Bielefeld oder Siegen. Heute spielen die Unterschiede keine solche Rolle mehr.
Als ich mich irgendwann etwas mehr für meine Vorfahren interessiert habe, habe ich durch Recherchen genauer herausgefunden, dass ein wesentlicher Familienzweig aus Beckum stammte, also einer urwestfälischen Gegend. Andere Äste und Zweige des Stammbaums führten nach Thüringen, aber das lassen wir hier mal beiseite.
Hat man nur lange genug in Westfalen gelebt, so berühren Heinrich Heines berühmte Zeilen über Westfalens Bewohner als „sentimentale Eichen“ tatsächlich noch heute einen Nerv; sogar dann, wenn man selbst nicht gerade als Eiche verwurzelt ist. Woran mag es wohl liegen? Sehnt man sich doch noch nach einer solchen Identifikation? Ganz ehrlich: Mich persönlich spricht Heines Dichtung mehr an als die proletarische Prosa eines Max von der Grün. Mit der Bergmannskultur konnte meine Generation nicht mehr so viel anfangen.
Vielleicht muss der doppelte Einfluss aus Westfalen und dem „Pott“ ja gar nicht so widersprüchlich sein. Möglicherweise hat er sich in der alten Zuspitzung erledigt. Wir sind doch, eigentlich von jeher und erst recht heute, ganz andere, vielfältigere Mischungsverhältnisse gewohnt. Dortmunds Bürgerinnen und Bürger stammen aus rund 180 Nationen. Und wenn nun gerade deshalb eine Neigung zum Heimatlichen aufkäme? Aber wenn die auch andere Wurzeln gleichwertig gelten ließe? So viele Konjunktive…
_________________________________
Der Beitrag stand, anders illustriert, ursprünglich in der allerletzten Ausgabe des Kultur- und Gesellschafts-Magazins WESTFALENSPIEGEL, das zum Jahresende 2025 leider eingestellt worden ist.