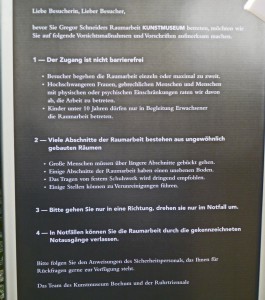„Everything that happened and would happen“ – bei der Triennale zeigt Heiner Goebbels ein Theater der Versatzstücke
Licht und Schatten, hell und dunkel. Szene aus Heiner Goebbels‘ neuer Produktion. Foto: Heinrich Brinkmöller-Becker/Ruhrtriennale
Heiner Goebbels gibt sich generös. Er wolle es gar nicht erst versuchen, mit seiner neuen Arbeit eine Botschaft zu vermitteln. Vielmehr habe er einen Raum mit Bildern, Worten und Geräuschen geschaffen, der das Publikum zu freier Imagination und Reflektion einladen soll. Doch das hehre Ansinnen erzeugt nur Ratlosigkeit: Goebbels’ Gesamtkunstwerk namens „Everything that happened and would happen“ entpuppt sich als kryptische theatralische Installation, als ein ziemlich beziehungsloses Konglomerat aus Musik, Licht, Performance, Sprache, Objekten und Filmen.
Die Produktion wurde 2018 in Manchester erstmals herausgebracht, nun hat die Ruhrtriennale das Werk als Deutsche Erstaufführung ins Programm genommen. Goebbels gibt in Bochums Jahrhunderthalle erneut den Sucher nach ungewöhnlichen Formen des Theatralischen, sieht die leere Spielfläche als Experimentallabor, wie er es schon während seiner Triennale-Intendanz (2012-2014) oft getan hat. Herausgekommen ist diesmal eine arge Zumutung fürs Publikum, eine Aufführung, die vor allem die große Verstörung in sich trägt.
Schon der Titel allein, ins Deutsche übersetzt „Alles was geschehen ist und geschehen würde“, scheint erschaffen aus dem Nebel des Unkonkreten. Etwas Kontur gewinnt diese Sentenz erst mit dem Blick auf die Textquelle, die Goebbels zum Ausgangspunkt seiner Produktion macht, Patrik Ouredniks Roman „Europeana – Eine kurze Geschichte Europas im 20. Jahrhundert“. Darin vermeidet der tschechische Autor allerdings jegliche Ansätze der linearen Geschichtsschreibung, setzt vielmehr Fakten neben Anekdoten, springt von der Pariser Weltausstellung (1900) zum Leben der Soldaten in den Schützengräben, listet Meinungen zum Berliner Holocaust-Mahnmal auf, oder beschreibt wie in einem Ritual, dass jemand zu irgendeinem Thema gerade irgendetwas sagt.
Tanz der Requisiten. Foto: Heinrich Brinkmöller-Becker/Ruhrtriennale
Es ist ein wild zusammengewürfelter, überkomplexer Text, aus dem Goebbels verschiedene Passagen lesen lässt, das Ganze mit rätselhaften Bildern kombiniert. Angereichert wird diese Flut optischer Reize bisweilen mit „No comment“-Einspielungen des Senders Euronews. Kommentarlos flimmern aktuelle Szenen aus allen Winkeln der Welt vor unseren Augen, Szenen von Menschen in der Masse, die demonstriert, die versunken ist in religiösen oder volkstümlichen Ritualen. Auf der Spielfläche werden unterdessen diverse Kisten, Kästen, Säulen, Rohre oder riesige, meist zerfetzte Tücher in undurchschaubarer Choreographie bewegt. Derweil diverse Musiker, mit ihrem Instrumentarium im Raum verteilt auf kleine Inseln der Klangerzeugung, eine hochdifferenzierte Geräusch-Kulisse auffächern.
Am Ende nur Nebel, Rauch und Zerstörung. Foto: Heinrich Brinkmöller-Becker/Ruhrtriennale
So entfaltet sich vor uns ein Theater ohne Schauspieler oder Sänger, in einer Atmosphäre, die die Bühne als Werkstätte begreift, wo Arbeiter Requisiten zu immer neuen, üppigen Tableaus formen. Heiner Goebbels mag dem Publikum jegliche Assoziationsfreiheit gestatten, doch liegt der Gedanke an eine Dystopie wohl nicht ganz fern. Schon weil sich die Musik am Ende in einen schier unerträglich lauten Klangflächenschrei hineinsteigert. Und weil das Schlussbild einer verwüsteten Fläche gleichkommt, nichts von friedvoller Idylle hat.
Goebbels’ Generosität, formuliert im Programmheft zu dieser Produktion, ist ein Trick. Sein Theater der Versatzstücke stiftet vor allem Verwirrung. Und während wir noch rätseln, ist alles bereitet fürs große Katastrophenszenario. Kein Wunder, dass manche dies mit kräftigen Buhrufen quittieren. Im Theater, so scheint’s, ist die Hoffnung und das Gute und Schöne endgültig ausgesperrt.
Weitere Aufführung am heutigen 26. August, 21 Uhr (ausverkauft)