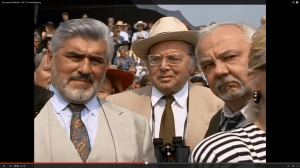Viel mehr als die Frau von „Ekel Alfred“: Zum Tod der Schauspielerin Elisabeth Wiedemann
Gustaf Gründgens spürte ihr gewaltiges Talent auf, holte sie ans Düsseldorfer Schauspielhaus. Diesem Ensemble blieb die gelernte Tänzerin (Staatsoper Berlin) bis 1955 verbunden. Seither beschritt sie viele berufliche Wege.
Ihre Karriere im Sprechtheater, dessen Faszination sie erst 1947 einfing, verlief weiträumig. Sie war in Frankfurt, Hamburg, München, Hannover, Köln, Wien und beim Deutschen Theater in Santiago de Chile, wo sie allerdings Regie führte. „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch servierte sie den Auswanderern der Nachkriegszeit, die damals recht zahlreich einer politischen Provenienz entstammten, die ihr zutiefst zuwider war. Die Rede ist von Elisabeth Wiedemann, der Kaufmannstochter aus Bassum bei Bremen, deren hochempörtes „Alfred!“ mir heute noch in den Ohren klingt. Sie starb im Alter von 89 Jahren.
Es ist ein böses Schicksal, wenn eine so wandlungsfähige Schauspielerin wie sie die Lebensbühne verlässt und dann vom zeilenversessenen Boulevard mit der Überschrift verabschiedet wird: „Die ‚dusselige Kuh‘ ist tot“. Elisabeth Wiedemann, die „Else“ von Vater „Alfred Tetzlaff“ (Heinz Schubert) in Wolfgang Menges wunderbarer Serie „Ein Herz und eine Seele“, sie wird eben heute noch von der Bunten-Blätter-Oberflächlichkeit mit den Abfälligkeiten des Chauvi-Ekels Alfred identifiziert. Und noch lieber bildhaft auf diese reduziert, auf seinen Gipfelspruch, wenn sie mal wieder so sehr naiv-entlarvend hinterfragte, was der weltgewandte (Soldat an der Ostfront) Alfred so alles fabulierte.
Nun lebt keiner mehr von der Erststaffel-Besetzung. Auch Hildegard Krekel (Tochter Rita) und Diether Krebs (Schwiegersohn Michi), die sich während der Dreharbeiten wechselseitig ganz toll fanden, sind tot. Aber lebendig blieb die widerborstige Grundhaltung dieser Episoden über den bundesdeutschen Spießer, dessen angebräunte Innereien immer noch nicht verdauten, dass ihr Land von der Demokratie eingenommen war. Alfreds Lieblingsfeinde waren die SPD und Willy Brandt. „Dieses Kellerkind aus Lübeck“, der „Mann mit dem Künstlernamen“, „uneheliches Kind“; mit seiner „Machtübernahme“, habe „eine ganze Nation Selbstmord begangen“. So rüpelte sich das nationale TV-Ekel durch die Dialoge vieler Folgen.
Dabei war jeder aus dem Familienquartett das krasse Gegenteil dessen, was politisch aus dem kleinen Giftzwerg quoll. Da machte Elisabeth Wiedemann keine Ausnahme. Ob in „Die Geschwister Oppermann“ oder „Das Tagebuch der Anne Frank“ (Bühnenfassung): Auseinandersetzungen mit der Nazi-Vergangenheit und der der antisemitischen Spießermentalität gehörten fest zu ihrem künstlerischen Lebensweg. Nicht zuletzt auch „Ein Herz und eine Seele“, die durch Wolfgang Menges boshafte Treffsicherheit, gepaart mit der Improvisationslust seiner Truppe, Einschaltquoten in Schwindelhöhe bekam. Und der Franz Xaver Kroetz von Ferne attestierte, die Sendereihe sei einzustellen, weil sie den kruden Sprüchen des Ekels zu viel Raum gebe, die üblen Löcher wieder in den Köpfen öffne.
Elisabeth Wiedemanns Lebensleistung war es, Zuschauer und Zuhörer zu unterhalten und dabei den Menschen was zum Nachdenken zu hinterlassen, auch wenn es mal etwas länger dauerte, bis die auf den Trichter kamen. Sie hatte wesentlich mehr verdient, als diese blöde Zeile von der „dusseligen Kuh“. „Alfred“ konnte machen, was er wollte, am Ende behielt „Else“ immer mit ihrer entwaffnenden Naivität die Oberhand.