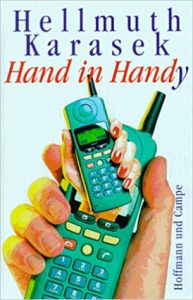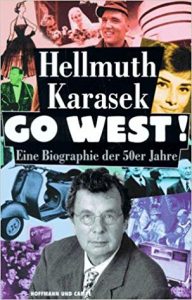Raddatz-Tagebücher: Im Haifischbecken der Literatur
Diese Lektüre hat sich hingezogen. 907 Seiten (plus Register) umfassen die Tagebücher der Jahre 1982-2001, die der Großkritiker, Autor und Publizist Fritz J. Raddatz jetzt vorgelegt hat. Es ist ein Wechselbad aus spannenden und ärgerlichen Passagen.
Frank Schirrmacher, FAZ-Mitherausgeber und früher FAZ-Kulturchef, wird auf der Rückseite des Buchs in goldenen Großbuchstaben zitiert: „Dies ist er endlich, der große Gesellschaftsroman der Bundesrepublik!“ Wie zum Dank für die jubelnde Empfehlung erscheint Schirrmacher in Raddatz‘ Tagebüchern nahezu als Lichtgestalt, als gebildet, höchst intelligent und allzeit gedankenschnell, überdies habe er zeitweise das beste Feuilleton der Republik geleitet. Beinahe so etwas wie eine jüngere Ausgabe seines Vorbildes Raddatz also.
Man kennt sich, man hilft sich? Nun ja. Meist ist das Gegenteil der Fall: Im grässlich eitlen, zunehmend verkommenen Kulturbetrieb, so jedenfalls der Grundtenor des gesamten Bandes, denke jeder nur an sich selbst. Hauen und Stechen, jeder gegen jeden. Da ist man als normalsterblicher Leser heilfroh, nicht mit bekannten Schriftstellern befreundet zu sein und nicht solche Imponier-Sätze notieren zu müssen: „Ich gebe auf dem Postamt Briefe an Grass, Botho Strauß, Hochhuth und Enzensberger auf…“ Pointe: Selbst der Postbeamte hieß (welch’ Zufall) Max Frisch.
Bloß nicht mit bekannten Autoren befreundet sein
Im Haifischbecken der egomanischen Literaten erkundigen sich selbst altgediente Freunde, wie etwa die Autoren Günter Grass oder Rolf Hochhuth, kaum einmal näher nach Arbeitsvorhaben und Befinden des Fritz J. Raddatz. Er leidet unter solcher Ignoranz wie ein Hund. Und nimmt permanent übel. Viele seiner Notizen sind (auch pekuniär besehen) buchstäblich „Abrechnungen“: Demnach würdigt man ihn stets zu wenig und lässt sich auch noch von ihm aushalten. Kaviar, Schampus oder edle Bordeaux-Weine gingen allzu oft auf seine Kappe. Ist er hingegen anderswo zu Gast, geht’s eher schäbig zu. Fast alle sind geizig, er ist großzügig. Du meine Güte!
Überaus leicht verletzliche Eitelkeit ist ein Wesenszug dieses Tagebuchschreibers, der darum ringt, nicht nur als erstklassiger Journalist, sondern als veritabler Schriftsteller zu gelten. Ergo: Ein eitler Pfau hält all den anderen Pfauen ihre Pfauenhaftigkeit vor. Und das über so viele Seiten hinweg. Es ist mitunter quälend. Gemildert wird die Suada bisweilen durch zerknirschte Selbsterkenntnis: „Ich habe mich in den Fäden der selbstgesponnenen Eitelkeit verfangen und finde nun aus diesem Netz nicht mehr heraus…“ Oder sogar: „Ich muß mich schon fragen, ob ich mich, meine angebliche Lebensleistung und meine nebbich Bedeutung, nicht enorm überschätze.“ Zwiespältiger Befund: „Weiß also nicht, was ich will. Man will ,beachtet‘ werden – und zugleich in Ruhe gelassen.“
Ungeachtet aller Widrigkeiten ging’s immer wieder frisch ins Getümmel. Über die Buchmesse jammern, aber sich jedes Jahr hinein stürzen. Auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten darf „man“ eben nicht fehlen. Doch manchmal übermannt Raddatz der Überdruss, der Ennui: In Zürich langweilen ihn die Museen, einschließlich der Cézanne-Bilder. Demonstrativer Seufzer des übersättigten Ästhetizisten: „Was soll man mir schon Neues bieten?“
Von 1977 bis 1985 war der frühere Rowohlt-Cheflektor Raddatz Feuilletonchef der Hamburger Wochenzeitung „Die Zeit“. Es waren dort wohl die lebendigsten Jahre dieses Ressorts. Dank Raddatz‘ vielfältigen Verbindungen zu Akteuren des hassgeliebten Literaturbetriebs schrieben damals die erlauchtesten Geister regelmäßig für das Blatt. 1985 wurde Raddatz wegen eines gar nicht mal so gravierenden, sondern eher lässlich-lachhaften Fehlers als Ressortleiter geschasst (er hatte in einer Buchmesse-Glosse Goethe mit dem – seinerzeit noch nicht existierenden – Frankfurter Bahnhof in Verbindung gebracht), blieb aber Autor der Zeitung, mit offenbar bestens gepolstertem Spesenkonto.
„70. Geburtstag. Grabstein gekauft.“
Dennoch: Das Leiden am Karrierebruch füllt viele Seiten des Tagebuchs. Eigentlich kein Wunder, dass der zusehends wehleidige Raddatz die Entwicklung der „Zeit“-Redaktion fortan als Niedergang wahrnimmt; erst recht, als Sigrid Löffler das Feuilleton übernimmt. Sein Selbstwertgefühl ist angekratzt und muss mühsam behauptet werden, zudem verspürt Raddatz Anzeichen des Alters. Später heißt es einmal wunderbar lakonisch: „70. Geburtstag. Grabstein gekauft.“ Vergällte Lebenslust – allem Luxus zum Trotz. Gegen Melancholie helfen natürlich weder die kunstsinnig ausstaffierten Wohnungen in Hamburg, auf Sylt und in Nizza, noch die teuren Fahrzeuge (erst Porsche, dann Jaguar).
Und der „Gesellschaftsroman“? Raddatz zeigt uns zahllose Prominente aus Kultur und Politik in Nahansicht. Der Mann hat so gut wie alle gekannt, die Rang und Namen hatten. Wer mitunter brillant formulierte Sottisen über Deutschlands wirkliche und vermeintliche Elite sucht, wird reichlich fündig. Darüber hinaus bietet das Buch tatsächlich Bruchstücke oder Bausteine einer bundesrepublikanischen Sittengeschichte. Doch ein Roman ist das alles bei weitem nicht.
Schreckenskabinett betrüblicher Gestalten
Wollte man eine Negativ-Rangliste aufstellen, so wären „Spiegel“-Begründer Rudolf Augstein (angeblich auf seine älteren Tage ein erbärmlicher Alkoholiker), die einstige „Zeit“-Mitherausgeberin Marion Gräfin Dönhoff („Kuh“), der selbstverliebt schwatzhafte Rhetoriker Walter Jens, dito „Literaturpapst“ Marcel Reich-Ranicki, Suhrkamp-Chef Siegfried Unseld und der hochmütige Germanist Hans Mayer einige der missliebigsten Figuren im Schreckenskabinett des Fritz J. Raddatz. Also vorwiegend Leute, die mit Raddatz um Kronjuwelen des Kulturbetriebs bzw. des Pressewesens rivalisier(t)en, so auch ein weiterer Kritiker-Kollege, der „miese Herr Karasek“ vom herzlich verachteten Schmutzblatt namens „Spiegel“. Namenlose Schreiberlinge sind in solchen Sphären ohnehin nicht satisfaktionsfähig.
Altkanzler und „Zeit“-Mitherausgeber Helmut Schmidt kommt nach Raddatz‘ Lesart – wie nahezu alle Politiker – als banausenhafter Simpel daher, TV-Promi Ulrich Wickert wird als ahnungsloser „Fernseh-Ansager“ vorgeführt. Raddatz bekundet, von tagtäglichen Politiker-Sorgen nichts wissen zu wollen, denn – so wörtlich – „man will ja auch nicht die Sorgen der Müllabfuhrmänner hören.“ Klar, mit denen kann man ja nicht über James Joyce oder die besten Bordeaux-Lagen reden. Zu solchem Dünkel passt diese Notiz von einer Lesereise: „Mich interessiert ‚mein Publikum‘ nicht; sie sollen lesen und die Klappe halten.“
Einmal in Fahrt, schmäht Raddatz auch Klassiker der Literatur als mindere Skribenten, so u. a. Tolstoi, Montaigne, Balzac, Proust und Roland Barthes. Wie denn überhaupt Frankreich vorwiegend mit Oberflächlichkeit assoziiert wird. Ein alter, erzdeutscher Topos, erstaunlich beim erklärten Linken Raddatz. Im Zuge der deutschen „Wende“ 1989/90 ereilt der Bannstrahl (Stichwort „Stasi-Connection“) auch Heiner Müller und Christa Wolf. Mehr Abschätziges gefällig? Nur wenige Beispiele: Dürrenmatt ist „etwas dumm“ (S. 83), Thomas Bernhard ein bloßer Literatur-Clown (S. 278), Adolf Muschg flach (S. 510), Fontanes Tagebücher sind nichtssagend (S. 579), Elfriede Jelinek ist läppisch und infam (S. 663), Kavafis banal (S. 724), das „Bürschlein“ Harry Rowohlt lediglich „von Beruf Erbe“ (S. 816).
Nur selten, aber immerhin blitzt zwischen all den harschen, längst nicht immer triftigen, ja oft haltlosen Urteilen auch Selbstkritik auf: „Oder irre ich mich aus Verdrossenheit?“ Zum Ausgleich werden ein Autor wie Kurt Drawert oder der eng befreundete Maler Paul Wunderlich in hohen Tönen gelobt. Stimmen hier noch die Maßstäbe?
Wenn Raddatz seine Schwester (Kosename „Schnecke“) schildert, genießt man einige der besten Passagen des Buches. Doch manchmal trägt er Privates unangenehm stolzgeschwellt zu Markte. So renommiert der schwule Kulturkritiker damit, dass er es in jüngeren Jahren u. a. mit Größen wie dem Beat-Poeten Allen Ginsberg oder dem Tänzer Rudolf Nurejew getrieben habe. Vollends peinlich ist das sexuelle Eigenlob auf dem Umweg über „Stimmen zum Spiel“: Raddatz lässt wissen, dass viele Herrschaften ihn als jeweils besten Liebhaber ihres Lebens bezeichnet hätten (S. 749).
Das üppige Textkonvolut hätte man kürzen können, es ist hie und da arg wiederholungsträchtig. Dann wäre Platz gewesen für erläuternde Anmerkungen (und aussagekräftige Fotografien), die man schmerzlich vermisst. Schon heute sind etliche Personen und Vorfälle nicht mehr vielen Menschen geläufig, in ein paar Jahren werden sie noch mehr verblasst sein.
Fritz J. Raddatz: „Tagebücher 1982-2001“. Rowohlt Verlag. 939 Seiten. 34,95 Euro.