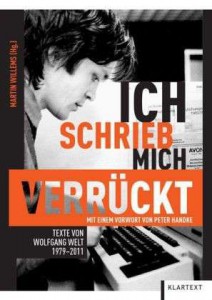Der doppelte Herbert: Fritsch und Grönemeyer mit dem schrillen Spaß „Pferd frisst Hut“ bei der Ruhrtriennale

Eine glückliche Braut sieht anders aus: Cécilia Roumi (als Hélène) und Christopher Nell (als Fadinard) im Slapstick-Operetten-Musical „Pferd frisst Hut“ (Foto: Thomas Aurin)
Da weiß einer nicht, was er will. Der Strohhut aus Florenz, dem Fadinard am Tag seiner Hochzeit wie verrückt hinterherjagt – das Original wurde nämlich von seinem Droschkenpferd gefressen – ist lediglich ein Symbol dafür, dass der Mann am liebsten Reißaus nehmen möchte: vor der Braut, der Verwandtschaft, der Hochzeitsgesellschaft, womöglich sogar vor sich selbst. Denn er scheint noch nicht einmal sicher zu sein, zu welchem Geschlecht er sich hingezogen fühlt.
In der Kraftzentrale des Duisburger Landschaftsparks zeigt die Ruhrtriennale jetzt eine neue Version von „Der Florentiner Hut“, einer Verwechslungskomödie von Eugène Labiche aus dem Jahr 1851. Das Stück hat diverse Spuren in den Künsten hinterlassen: Es gibt eine gleichnamige Oper von Nino Rota (der die Filmmusik zu „Der Pate“ schrieb), einen deutschen Film mit Heinz Rühmann (Regie: Wolfgang Liebeneiner), dazu noch zwei französische Filme.
Als Slapstick-Operetten-Musical präsentiert die Ruhrtriennale die deutsche Erstaufführung von „Pferd frisst Hut“, eine Produktion des Theaters Basel in Koproduktion mit der Komischen Oper Berlin. Federführend sind zwei Männer, deren unverwechselbar Stil hier eigenwillig aufeinander prallt.
Das ist zum einen der Regisseur Herbert Fritsch, dafür bekannt, seine Figuren auf der Bühne in einen hyperaktiven Irrsinn zu treiben: in ein kindliches, zugleich bis in die kleinste Geste hinein choreographiertes Herumtoben. Manche mögen sich erinnern, welchen Kultstatus seine Produktion „Murmel, Murmel“ an der Berliner Volksbühne erreichte, bevor er 2018 am Bochumer Schauspielhaus mit der „Philosophie im Boudoir“ von Marquis de Sade ein Skandälchen lostrat.
Für Zugkraft beim Publikum sorgt die Musik von Herbert Grönemeyer, der in seinen Jugendjahren musikalischer Leiter am Bochumer Schauspielhaus war, bevor er 1981 durch „Das Boot“ bekannt wurde und 1984 mit seinem Studioalbum „Bochum“ die Hitparaden stürmte. Aus seinen Melodien, Rhythmen und Texten hat Thomas Meadowcroft eine Partitur für Chor und Sinfonieorchester gemacht: geschickt instrumentiert, fröhlich zwischen Broadway-Musical, Rossini-Oper und Disney-Soundtrack irrlichternd. Die Bochumer Symphoniker und der Chor des Theaters Basel, die unter der Leitung des amerikanischen Dirigenten Thomas Wise Stimmung machen, streuen Glamour über diese unterhaltsame Mischung.
Was aus der Zusammenarbeit der beiden Herberts entstand, ist so schräg und bunt, wie es die Bühne von Herbert Fritsch (unter Mitarbeit von Oscar Mateo Grunert) gleich zu Beginn erahnen lässt. Das temporeiche Tür-auf-Tür-zu-Spektakel kommt durch acht Zugänge in den Seitenwänden und ein Drehportal vor Kopf in Schwung. Selten war eine Handlung so sehr Nebensache: Hier geht es um eine Typenparade, um die große Orientierungslosigkeit, in der die Figuren haltlos herumstolpern.
So grell und banal das auf den ersten Blick scheint, so hintergründig ist es auf den zweiten, denn nichts und niemand ist in diesem Absurdistan ernst zu nehmen. Wir erleben leere Witzfiguren, die Sprechblasen absondern wie in einem Comic: „S’isch alles aus!“, jault der Schwiegervater bei jedem Auftritt in weinerlichem Dialekt, während der Bürgermeister bei jeder Gelegenheit stöhnt, wie heiß ihm doch sei. Das Gestotter und Gestammel der Hauptfigur Fadinard steckt voll absichtsvoller Versprecher. Wenn er mit Glottisschlag von den Baron*innen spricht, schiebt er stets das Wort „drinnen“ hinterher, wie um den Genderwahnsinn auf die Spitze zu treiben.
Dazu zeigen die Schauspielerinnen und Schauspieler ein akrobatisches Bewegungstalent, als wollten sie sich für den Zirkus bewerben. Sie rutschen ganz beiläufig in den Spagat, hechten die von der Drehtür herabführenden Treppenstufen herunter, landen auf dem Bauch, überschlagen sich in der Luft. Es ist rasant, es ist sagenhaft. Fritsch hat jede Verrenkung durchgeformt, bis ins Detail, ja sogar bis in den Schlussapplaus hinein.
Der Grönemeyer-Sound ist der Musik bei allen Musical-Anleihen deutlich anzuhören: Vieles klingt in Duisburg irgendwie nach „Bochum“. Die Emotionalität der Songs steht oft seltsam quer zu der alles und alle umfassenden Ironie, die Fritschs rasantes Anarcho-Theater so vergnüglich macht. Aber es gibt Chornummern, die gut zünden, sogar zum Mitklatschen anregen. Der Chor des Theaters Basel zieht in den farbenfrohen Kostümen von Geraldine Arnold eine echte Show ab.
In Erinnerung bleibt ein schriller Spaß, der bei weitem nicht so flach ist, wie er zu sein vorgibt. Um es mit den Worten von Herbert Fritsch zu sagen: „Wir sind alle irre, wir kriegen nix gebacken, und wir kriegen gar nix hin.“ Wer wollte ihm in diesen Zeiten widersprechen?
(www.ruhrtriennale.de)






 „
„