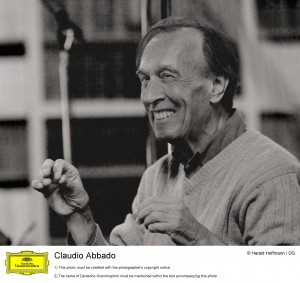Violinspiel wie von einem anderen Stern: Eine Woche mit der Geigerin Hilary Hahn im Konzerthaus Dortmund

Hilary Hahn durfte als „Curating Artist“ ihr eigenes Festival im Konzerthaus Dortmund gestalten. Eine Woche lang trat sie dort täglich auf, mit wechselndem Programm. (Foto: Petra Coddington)
Sie ist zweifache Mutter, dreifache Grammy-Preisträgerin, 43 Jahre alt und fraglos eine der besten Geigerinnen unserer Zeit. Die Amerikanerin Hilary Hahn erreicht in ihrem Violinspiel eine Perfektion wie von einem anderen Stern. Zugleich ist sie das Gegenteil einer hochglanzpolierten Künstlerin: Sie präsentiert sich nahbar und erstaunlich ungeschminkt. So auch im Konzerthaus Dortmund, wo sie als „Curating artist“ ihr eigenes Festival gestalten durfte: „Hilary Hahn & friends“.
Den Freibrief, den das Konzerthaus ihr für diese Woche ausstellte, nimmt sie als Gelegenheit, um mit Freunden zu musizieren und Neues auszuprobieren. Auch eine öffentliche Meisterklasse ist Teil des Programms. Bezeichnend, dass sie dafür nicht die besten Studierenden der umliegenden Musikhochschulen herausgepickt hat, sondern ganz normale Geigenschülerinnen- und -schüler aus Dortmund und Umgebung unterrichtet.
Der Weg ist das Ziel, sagt Hilary Hahn, und Wahrhaftigkeit wichtiger als Makellosigkeit. Mit voller Absicht präsentiert sie Stücke auf Instagram in unfertigem Zustand, zeigt sich selbst beim Üben, manchmal unfrisiert oder gar im Schlafanzug. Gerade Frauen sollten sich öfter trauen, weniger perfekt in der Öffentlichkeit aufzutreten, sagt sie beim eröffnenden Podiumsgespräch mit Konzerthaus-Intendant Raphael von Hoensbroech – und erntet dafür spontanen Beifall.
Den eigentlichen Auftakt gestaltet sie einen Tag später, gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Andrés Orozco-Estrada. Tschaikowskys Violinkonzert wirkt unter ihren Händen wie mit klarem Wasser gereinigt. Wie nebenbei befreit Hilary Hahn das nahezu totgespielte Repertoirestück von angeberischen Gebärden, von süßlicher Gefühlsseligkeit und all den Schlieren des schlechten Geschmacks, mit denen man es häufig hört. Bei ihr erhält das Werk einen tänzerisch-biegsamen Charakter, grüßt zu Tschaikowskys großen Ballettmusiken hinüber.
Ihr Violinton ist nie aufgedonnert, suhlt sich nie in der Saite. Er bleibt stets fein, kann bestürzend verletzlich klingen, aber auch durchdringend kristallin. Das ist keinesfalls mädchenhaft, denn Hahn ist zugleich eine überragende Virtuosin, die Höchstschwierigkeiten mit voller Attacke in die Saiten meißelt. Die große Solo-Kadenz im Kopfsatz steht exemplarisch für ihre Deutung. Statt eine Bravourshow abzuziehen, wandelt sie auf dem schmalen Grat zwischen Verlorenheit und Rebellion.
Auf die Beifallsstürme antwortet Hilary Hahn mit zwei Solo-Stücken von Bach. Das Andante aus der a-Moll-Sonate wird zu einer Sternstunde: in dieser Ruhe, in dieser Reinheit, in dieser Überlegenheit macht ihr das niemand nach.
Die seltene, aber klanglich reizvolle Kombination von Geige und Orgel probiert sie gemeinsam mit Iveta Apkalna aus. Grundpfeiler dieses Programms ist die berühmte Ciaconna aus der d-Moll-Partita für Solovioline von Johann Johann Sebastian Bach. Das Stück dreht sich um Tod und Auferstehung: Es besteht aus freien Variationen über einem Thema in der Bass-Stimme, das ununterbrochen wiederholt wird. Ein ständig um sich selbst kreisender Gedanke, den Bach 32 Mal variiert. Hilary Hahn durchmisst dieses Planetensystem zunächst allein, im traumwandlerischen Gleitflug. Danach lässt Iveta Apkalna die Majestät der mehr als 3565 Pfeifen der Konzerthausorgel aus dem Hause Klais erstrahlen.
Wie unerschrocken Hilary Hahn über den Tellerrand schaut, zeigt das „Joker“-Konzert mit dem südafrikanischen Cellisten Abel Selaocoe und dem Bantu Ensemble als Überraschungsgästen. Sie wagt es, ein paar Töne zum Spiel dieser experimentell angehauchten Improvisationskünstler beizutragen, überlässt ihnen schließlich aber doch die Bühne.
Was folgt, gleicht einer Klangreise nach Afrika. Abel Selaocoe ist ein Künstler mit riesiger Bandbreite: Sprache, Gesang, Cellospiel, Schnalz- und Zungenlaute gehen bei ihm nahtlos ineinander über. Mit überbordender Energie animiert er das Publikum zum Mitmachen, heizt die Temperatur im Saal so lange an, bis alle stehen, tanzen, feiern. Schlagzeuger Dudù Kouaté zaubert mit afrikanischen Instrumenten die schönsten Stimmungen in den Saal.
Mit dem Kaleidoscope Chamber Collective, das der Londoner Wigmore Hall eng verbunden ist, unternimmt Hilary Hahn einen Streifzug durch die amerikanische Musik des 20. Jahrhunderts. Der Abend wird vom Publikum zu Recht gefeiert: Zu erleben ist spannende Kammermusik auf allerhöchstem Niveau. Jennifer Higdons „Dark Wood“ für Fagott, Violine, Violoncello und Klavier enthält köstlich groteske Elemente. Samuel Barbers Streichquartett op. 11, von dem fast alle nur den 2. Satz als „Adagio for strings“ kennen, erfährt endlich einmal eine Gesamtaufführung. Aaron Coplands „Appalachian spring“ Suite gleicht einem faszinierenden Kaleidoskop: Farben und Formen gruppieren sich immer neu, mit leuchtender Transparenz.
Auch vor Live-Elektronik scheut Hilary Hahn nicht zurück. In Dortmund tritt sie als „Special Guest“ mit dem Cellisten Seth Parker Woods auf, der sein multimediales, halb-biographisches Programm „Difficult Grace“ hier in einer Variation präsentiert. Verschränkt mit einigen Solostücken von Bach kommt hier das späte 20. und frühe 21. Jahrhundert zum Klingen: Werke von Coleridge-Taylor Perkinson, Giacinto Scelsi, Nathalie Joachim, Monty Adkins, Conrad Beck, Carlos Simon und Chinary Ung, natürlich auch das titelgebende Stück von Fredrick Gifford, in dem der Cellist zugleich Erzähler, Schauspieler und Sänger ist.
Zum Abschluss fegt ein Wirbelsturm aus Kolumbien durchs Haus. Dirigent Andrés Orozco-Estrada, mit dem Hilary Hahn besonders gerne musiziert, kehrt mit der Jungen Philharmonie seines Heimatlandes zurück, die Musikerinnen und Musiker zwischen 16 und 24 Jahren vereint. Gefördert von einer Stiftung, ist sie nicht nur ein wichtiges Bildungs- und Sozialprojekt, sondern ein künstlerisches Kollektiv, das durch Können und Kreativität besticht.
Das Violinkonzert von Felix Mendelssohn Bartholdy, das unter Hilary Hahns Händen funkelt und blitzt, kommt ihrem kristallinen Ton ganz besonders entgegen. Aber was die jungen Kolumbianer in Igor Strawinskys Musik zum Ballett „Petruschka“ treiben, ist abenteuerlich. Der Handlung des Balletts entsprechend, machen sie die Bühne zum Jahrmarkt: treten in fröhlich lärmenden Gruppen auf, spielen die Szenen nach wie Schauspieler, oft gleichzeitig musizierend.

Halbszenische Aufführung: Die Musikerinnen und Musiker der Jungen Philharmonie Kolumbiens spielen die Ballettmusik „Petruschka“ mit Masken und agieren wie Schauspieler. (Foto: Petra Coddington)
Es bekommt der Kunst bekanntlich nicht immer gut, wenn der Konzertsaal zum Zirkus wird. Aber diese Performance ist von Martin Buczko auf den Punkt genau durchchoreographiert. Sie wird musikalisch und darstellerisch so überzeugend präsentiert, dass jede Skepsis dem Hör- und Sehvergnügen weicht.
Da werden Geiger zu Marionetten und Hornisten zu Hanswursten, die sich den Trichter ihrer Instrumente auf den Kopf setzen, als seien es komische Hüte. Die Posaunisten heben ihre Instrumente in die Höhe, als wollten sie Ausrufezeichen setzen, und die Geiger schwenken ihre Bögen durch die Luft, als wollten sie nach etwas angeln. Am Kontrafagottisten ist glatt ein Pantomime verloren gegangen. Bunte Masken erheben die farbenreiche Musik vollends zum Fest.
Nach dem Schlusston herrscht Partystimmung, auf der Bühne und abseits davon. Sie setzt sich im Foyer fort: Einige Blechbläser und Schlagzeuger des Orchesters finden kein Ende, feiern zu den Klängen und Rhythmen Kolumbiens weiter. Und während einige noch an der Garderobe anstehen, tanzen andere schon ausgelassen mit.