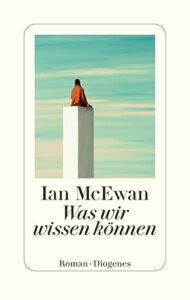Wie die Zukunft der Welt vergeigt wurde – Ian McEwans raffinierter Roman „Was wir wissen können“
Er ist ein Gigant der Gegenwartsliteratur. Ob „Abbitte“ oder „Kindeswohl“: Seine Romane haben Bestseller-Garantie und werden erfolgreich verfilmt. Ian McEwan hat für seine politisch brisanten und ziemlich bizarren Bücher unzählige Preise bekommen. Nur einen noch nicht: den Literaturnobelpreis.
In seinem Roman „Was wir wissen können“ entwirft er mit stilistischer Eleganz und lakonischer Ironie ein Bild davon, wie die Welt in einhundert Jahren aussehen könnte, wenn wir – wie leider anzunehmen – sehenden Auges in den Abgrund der Klimakatastrophe und der atomaren Kriege steuern.
Weil er aber kein trauriger Bänkelsänger ist, surft McEwan auf einer fast heiteren literarischen Welle durch die Zeiten, springt munter zwischen Heute und Morgen, verwickelt einen literarischen Stellvertreter in ein Erzähl-Geflecht, das zu einer abenteuerlichen Schnitzeljagd wird.
Der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe blickt mit dem Wissen des Jahres 2119 auf unsere Gegenwart zurück: Sein Spezialgebiet ist die Literatur zwischen 1990 und 2030, er will herausfinden, ob und wie die Werke dieser Epoche auf die nahende ökologische und politische Katastrophe reagiert hat. Thomas liebt diese Ära der Widersprüche und des Überflusses, in der die Zukunft noch rosig schien – und dann doch alles aus Überdruss und Dummheit vergeigt wurde.
Die Welt, in der Thomas lebt, ist trist und tödlich: Weil die KI entschieden hat, dass Angriff die beste Verteidigung ist, wurden mehrere Atomkriege geführt. Die Wucht der Explosionen löste ungeheure Tsunamis aus und setzte große Teile der Erde unter Wasser. Russland hat den aus dem Wasser ragenden Rest von Europa annektiert. England ist nur noch ein Archipel aus vielen kleinen Inseln.
Wenn Thomas von seiner Insel mit einem Boot zu jenem Eiland reisen will, auf der er ein verschollenes Gedicht vermutet, das ihm Antworten auf Fragen der Literaturgeschichte geben könnte, ist das ein gefährliches Abenteuer. Dieses Gedicht, das nur ein einziges Mal vorgelesen und niemals gedruckt wurde, ist für Thomas der Heilige Gral der Erkenntnis und Wahrheit. Francis Blundy, der größte Dichter seiner Zeit, hat es seiner Frau Vivien im Jahr 2014 geschenkt und bei ihrer Geburtstagsfeier vorgetragen. Danach verschwand es, wurde Stoff für Legenden und Vermutungen.
Thomas kennt alle Dokumente und Informationen, die jemals über das Gedicht verbreitet wurden. Aber wenn er seine Arbeit zu einem glücklichen Ende führen will, reicht es nicht, dass er Leben und Werk von Francis Blundy zu kennen glaubt und verliebt ist in Vivien und ihr geheimnisvolles Wesen. Um der Wahrheit näher zu kommen, muss er das Gedicht finden. Aber was er dann ausbuddelt, stellt seine Vorstellungen von dem, was wir wissen können, völlig auf den Kopf.
Ian McEwan holt – Abrakadabra – den literarischen Zauberstab heraus und zeigt uns lächelnd, dass wir rein gar nichts wissen, weil alle Beteiligten aus guten Gründen nur Lebenslügen verbreitet und ihre vertrackten Liebesaffären mit rhetorischen Finessen vernebelt haben. Ist der erste Teil des Romans bereits ein grandioses Puzzle über Fakten und Fiktionen, so ist der zweite Teil ein literarisches Meisterwerk bizarrer Enthüllungen und absurder Desillusionierungen. Seinem Spitznamen „Ian Macabre“ macht der Autor hier wieder einmal alle Ehre.
Ian McEwan: „Was wir wissen können“. Roman. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Diogenes Verlag, Zürich 2025, 480 Seiten, 28 Euro.