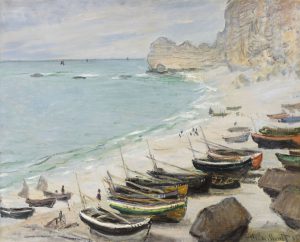Die Sammlung um und um gewendet: „REMIX“ im Dortmunder MKK

Besonderheit in der MKK-Kunstsammlung – Caspar David Friedrich: „Winterlandschaft mit Kirche“, 1811 (© MKK, Madeleine-Annette Albrecht)
Dortmunds Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK) will verstärkt Emotionen ansprechen. Darauf deuten jedenfalls Texte des städtischen Hauses zur Ausstellung „REMIX“ hin. Zitat: „Wen schaut sie an, die schöne Italienerin, die Theobald von Oer malte? Was geht der geheimnisvoll nachdenklichen Leontine des Anselm von Feuerbach durch den Kopf?“
Aha, sie wollen uns also bei den menschlichen Gefühlen packen, auf dass die Kunst noch einmal andere Spannung gewinne; selbst dann, wenn man einzelne oder etliche Bilder schon kennen sollte. Dann noch ein flottes englisches Titelwort darüber gesetzt – und beinahe fertig ist die neu aufgemischte Schau „REMIX. 800 Jahre Kunst entdecken“.
Doch halt! So simpel ist es natürlich nicht gewesen. Im Gegenteil. Am Anfang stand die Qual der Wahl aus umfangreichen eigenen Beständen, wobei man sich zunächst auf Gemälde und Skulpturen konzentriert, also sozusagen als Kunstmuseum reinsten Wassers agiert. Und siehe da: Dieses Haus verwahrt offenkundig beachtliche Schätze, zu denen beispielsweise auch zwei kleinere Formate von Caspar David Friedrich (eine Winterlandschaft von 1811, ein Junotempel in Agrigent von 1826) zählen. Wer weitere klangvolle Namen hören will, bitte sehr: Jacob Jordaens, Tischbein, Feuerbach, Spitzweg, Slevogt, Corinth, Liebermann. Andere, historisch entschiedener den Künsten zugeneigte Städte mögen auf dem weiten Felde noch mehr zu bieten haben, aber immerhin…
800 Jahre auf 800 Quadratmetern
Ob Zahlenzufall oder nicht: Auf 800 Quadratmetern gibt es nun Kunst aus rund 800 Jahren zu sehen – chronologisch geordnet vom strengen romanischen Mittelalter über die schon deutlich bewegtere Gotik bis hin zum Impressionismus und zum Jugendstil. Hier ließe sich „auf die Schnelle“ ein kunstgeschichtlicher Parforceritt absolvieren – oder es könnte die ungleich bessere Devise gelten: Bei freiem Eintritt mehrmals wiederkommen und sich einzelnen Stücken oder Werkgruppen genauer widmen. Zeit genug gibt’s dafür allemal, denn diese Auswahl im Gewand einer Wechselausstellung ist vorerst für längere Zeit die neue Dauerschau. Und die soll vor allem „Geschichten erzählen“, auch und gerade aus dem uns scheinbar so fern liegenden Mittelalter.

Biedermeierliche Szene: Louise Henry „Die Familie Felix Henri du Bois Reymond“ (© MKK, Madeleine-Annette Albrecht)
Zwar kommt „REMIX“ ohne Leihgaben aus, mithin auch ohne aufwendige Ferntransporte oder komplizierte Verhandlungen. Doch verbirgt sich hinter dieser Sichtung des Eigenbesitzes eine Menge Forschungsarbeit, nach der manches Exponat in einem etwas anderen Licht erscheint. Von der Klärung der Herkunft (Provenienz) bis zur behutsamen Restauration und zur nachhaltigen Digitalisierung reicht das Spektrum der Maßnahmen. Einige Einblicke in solche Prozesse begleiten denn auch diese Ausstellung; mal in Vitrinen, mal als mediale Aufbereitung. Ann-Kathrin Mäker, zuständig für Bildung und Vermittlung, spricht von „Vertiefungs-Ebenen“.
MKK-Direktor Jens Stöcker hatte vor sechs Jahren, als er nach Dortmund kam, versprochen, das Museum solle und werde sich ändern. Seither arbeitet er mit seinem ständig verjüngten Team an der Umsetzung. Stöckers Stellvertreter, Sammlungsleiter Christian Walda, fungiert als Kurator der REMIX-Zusammenstellung mit etwa 110 Exponaten. Insgesamt nennt das MKK rund 230 Gemälde und Skulpturen sein Eigen, es ist also nahezu die Hälfte dieses Bestandes zu sehen, darunter übrigens kaum Depot-Stücke, sondern zuallermeist solche, die bereits in diversen Ecken des Museums hingen und nun zusammengeholt wurden, was einen ganz anderen Kontext für die Einzelwerke schafft. Selbst Stöcker und Walda waren mitunter von der veränderten Wirkung überrascht.
Nach 22 Jahren war eine Revision fällig
Nach und nach sollen weitere ausgewählte Stücke im REMIX gezeigt werden, zeitweise auch besonders empfindliche Arbeiten auf Papier (Druckgraphik, Zeichnungen) und Fotografie. Das Ganze soll schließlich – im Zuge einer gründlichen Gebäudesanierung – in ein erneuertes Sammlungskonzept münden. Die bisherige Dauerausstellung war mittlerweile 22 Jahre alt und leicht „angestaubt“, da musste tatsächlich frischer Wind hinein.

Porträt aus dem Umkreis des Jugendstils, gegen Ende des MKK-Rundgangs – Hans Christiansen: „Bildnis Änne Glückert“, 1906 (© MKK, Jürgen Spiler)
Als kulturgeschichtliches Institut besitzt das MKK nicht nur Gemälde und Plastiken, sondern umfangreiche Sammlungen aus Archäologie, Historie, Vermessungstechnik, Kunsthandwerk, Design und Volkskunde. Imposante Zahlen: Die gesamte Sammlung umfasst rund 73.000 Objekte, davon werden über 10.000 Exponate auf sechs Ebenen mit 6000 Quadratmetern präsentiert. Ob man das in Dortmund und der Region weiß – und ob man es zu schätzen weiß?
„REMIX. 800 Jahre Kunst“. Dortmund, Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK), Ausstellungshalle, Hansastraße 3. Neue Dauerschau ab 24. Februar 2023, teilweise wechselnd bestückt bis 2025.
Eintritt frei. Öffnungszeiten: Di und Fr bis So 11-18 Uhr, Mi und Do 11-20 Uhr. Infos zu Führungen und Veranstaltungen: 0231 / 50-260 28.
Extra-Homepage: https://remix-dortmund.de